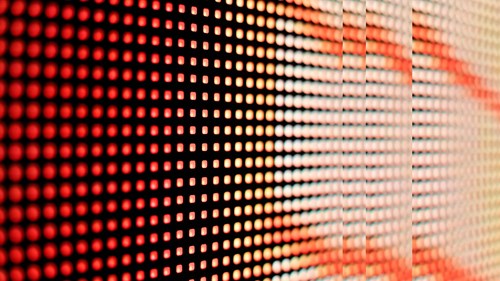Kartellschadensersatz: Weitere Stärkung der privaten Kartellrechtsdurchsetzung
Competition Outlook 2025
Eine weitere Stärkung der privaten Kartellrechtsdurchsetzung prägte die Rechtsprechung des Jahres 2024. Aus Art. 101, 102 AEUV und dem Prinzip effektiver Durchsetzung europäischen Rechts leitet der Gerichtshof der Europäischen Union teils weitreichende Auswirkungen auf das nationale Recht her – auch für die Zeit vor Inkrafttreten der Kartellschadensersatzrichtlinie (Richtlinie 2014/104/EU).
Im Vorabentscheidungsverfahren zu einer Schadensersatzklage der tschechischen Vergleichsplattform Heureka gegen Google (Urteil v. 18.04.2024, C-605/21) gab der Gerichtshof der Europäischen Union Leitplanken zum Umgang mit Verjährung vor. Der Gerichtshof stellte fest, dass die kenntnisabhängige Verjährung der im nationalen Verfahren streitgegenständlichen kartellrechtlichen Schadensersatzansprüche wegen eines Verstoßes gegen Art. 102 AEUV erst dann beginnen könne, wenn der Wettbewerbsverstoß beendet ist und der Geschädigte Kenntnis von den für die Klageerhebung notwendigen Informationen erlangt hat. Die anderslautende streitgegenständliche tschechische Regelung verstoße gegen den Effektivitätsgrundsatz und die Vorgaben der Kartellschadensersatzrichtlinie. Hieran knüpft eine intensive Debatte auch im deutschen Recht an.
Weiter im Fokus stehen Fragen der internationalen Gerichtszuständigkeit: In der Entscheidung MOL (Urteil v. 04.07.2024, C-425/22, siehe Noerr Insights) lehnte der Gerichtshof eine Zuständigkeit der Gerichte am Sitz der nur mittelbar geschädigten Muttergesellschaft ab – auch unter Berücksichtigung der bestehenden Rechtsprechung zur der „wirtschaftlichen Einheit“ (vgl. auch Urteil v. 11.07.2024, C-632/22 – Volvo zu Fragen der internationalen Zustellung). Demgegenüber plädiert Generalanwältin Kokott in ihren Schlussanträgen in der Sache Heineken (26.09.2024, C-393/23) dafür, unter bestimmten Voraussetzungen auch eine Zuständigkeit am Sitz der Muttergesellschaft nach Art. 8 Abs. 1 EuGVVO anzunehmen.
Aus deutscher Sicht bedeutsam ist die Entwicklung im Bereich der Kartell-Sammelklagen. In seinen Schlussanträgen plädiert Generalanwalt Szpunar dafür, dass effektive Kartellrechtsdurchsetzung bei Stand-Alone-Klagen einen Zugang zu kollektivem Rechtsschutz verlangt. Ein grundsätzliches Verbot eines Sammelklage-Inkassomodells bei Kartellschadensersatzansprüchen sei unzulässig (C-253/23 – ASG 2), wobei Fragen unbeantwortet bleiben (siehe Noerr Insights). Das Urteil darf hier mit Spannung erwartet werden und ist für den 28.01.2025 angekündigt.
Auf nationaler Ebene steht weiter die Frage der Schadensschätzung im Vordergrund. Sie wird auch 2025 die Tatgerichte herausfordern. Der Bundesgerichtshof erleichtert in der Sache LKW IV (Urteil v. 09.07.2024, KZR 98/20) die Anforderungen für Kartellgeschädigte, ihre Klage zu begründen. Der Bundesgerichtshof entschied, dass den Tatgerichten bei der Feststellung des Schadens dem Grunde nach § 287 ZPO grundsätzlich ein weites Ermessen zustehe. Der Kläger müsse, damit ein Tatgericht einen Schaden feststellen kann, (nur) die greifbaren Anhaltspunkte vortragen, zu deren Darlegung er ohne Weiteres in der Lage ist. Dazu gehöre – je nach Einzelfall – nicht die Vorlage einer eigenen Vergleichsmarktanalyse. Parteigutachten bleiben aber relevant, denn in der Entscheidung LKW V (Urteil v. 01.10.2024, KZR 60/23) bestätigte der Bundesgerichtshof seine vorhergehende Rechtsprechung und stellte klar, dass der Tatrichter im Rahmen des § 287 Abs. 1 ZPO zur umfassenden Würdigung insbesondere der von den Parteien vorgelegten Privatgutachten verpflichtet sei und auf dieser Grundlage die Erforderlichkeit eines etwaigen eigenen Gerichtsgutachtens zu prüfen habe.
Dieser Artikel ist Teil des Competition Outlook 2025. Alle Artikel des Competition Outlooks finden Sie hier.
Bestens
informiert
Jetzt unseren Newsletter abonnieren, um zu aktuellen Entwicklungen auf dem Laufenden zu bleiben.
Jetzt anmelden