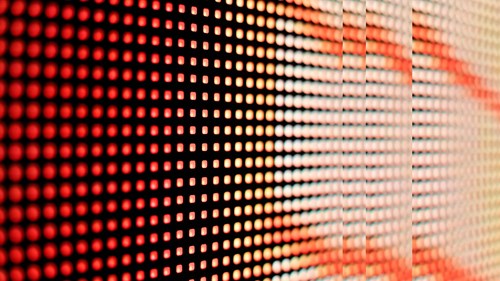Auf Worte folgen Taten: EU reagiert prompt auf die Herausforderungen durch US-Zölle
Nach anfänglicher Zurückhaltung hat die EU nunmehr auf die von US-Präsident Trump erneut eingeführten Zölle in Höhe von 25 % auf Stahl und Aluminium reagiert.
Am 10. Februar 2025 setzte US-Präsident Trump seine Section 232-Zölle erneut in Kraft und legte damit einen Zollsatz in Höhe von 25 Prozent auf alle in die USA eingeführten Stahl- und Aluminiumprodukte fest. Als Reaktion darauf stellte die EU-Kommission wiederum am 12. März 2025 - dem Tag, an dem diese US-Zölle in Kraft traten - eine Reihe von Gegenmaßnahmen vor.
Zunächst plant sie, die ursprünglich 2018 eingeführten und 2021 ausgesetzten Zölle auf bestimmte US-Exporte wie Harley-Davidson-Motorräder und Kentucky Bourbon mit Wirkung vom 1. April 2025 wieder einzuführen. Darüber hinaus beabsichtigt die EU-Kommission aber auch, bis Mitte April weitere Gegenmaßnahmen einzuführen, die potenziell auf amerikanische Agrarprodukte und Technologiegüter abzielen. Diese beiden Maßnahmen haben verschiedene US-Produkte im Blick und sollen den durch die US-Zölle auf Stahl und Aluminium in der EU entstehenden wirtschaftlichen Schaden in Höhe von voraussichtlich 26 Milliarden Euro abmildern. Die Ankündigung über die Gegenmaßnahmen erfolgte zwei Tage nachdem EU-Handelskommissar Maroš Šefčovič gegenüber Reportern erklärt hatte, dass die US-Regierung nicht bereit sei, ein Abkommen auszuhandeln, um den drohenden Handelskonflikt zwischen den USA und der EU zu verhindern.
I. Zölle nach US-Recht
Die von US-Präsident Trump am 10. Februar 2025 verhängten US-Zölle stützen sich auf Section 232 des Trade Expansion Act von 1962 (19 US Code § 1862). Diese Rechtsgrundlage erlaubt es dem US-Präsidenten, Einfuhrbeschränkungen zu verhängen, nachdem das US-Handelsministerium festgestellt hat, dass bestimmte Einfuhren die nationale Sicherheit der USA gefährden. Was jedoch eine Bedrohung der nationalen Sicherheit der USA darstellt, ist nicht eindeutig. Traditionell legt das US-Handelsministerium den Begriff dergestalt aus, dass er sich auf drei Kategorien nationaler Sicherheitsanforderungen bezieht: direkte Verteidigung (d. h. Waffenproduktion), indirekte Verteidigung (d. h. für die Waffenproduktion benötigte Lieferungen) und zivile Nachfrage (d. h. Lieferungen zum Schutz der Zivilbevölkerung in Notzeiten). In jüngster Zeit konzentrierte sich die Bewertung des US-Handelsministeriums jedoch auf wirtschaftliche Erwägungen im weiteren Sinne. Solche wirtschaftlichen Erwägungen werden zwar auch in Section 232 erwähnt, aber die Bestimmung verknüpft sie ausdrücklich mit der Frage, „ob eine solche Schwächung unserer Binnenwirtschaft die nationale Sicherheit beeinträchtigen kann“.
US-Präsident Trump hatte bereits während seiner ersten Amtszeit auf Section 232 als Rechtsgrundlage zurückgegriffen, um Zölle auf Stahl- und Aluminiumprodukte zu erheben. Im Jahr 2017 wies er den damaligen US-Handelsminister Wilbur Ross an, eine Untersuchung der Auswirkungen von Stahl- und Aluminiumeinfuhren auf die nationale Sicherheit der USA durchzuführen. Im Februar 2018 kam das US-Handelsministerium zu dem Schluss, dass die Einfuhren von Stahl- und Aluminiumerzeugnissen die nationale Sicherheit der USA gefährden. Auf der Grundlage dieses Berichts verhängte US-Präsident Trump im März 2018 sodann Zölle von 25 % auf Stahl- und 10 % auf Aluminiumeinfuhren.
II. Die Gegenmaßnahmen der EU im Rahmen der Durchsetzungsverordnung
Im Juni 2018 ergriff die EU Vergeltungsmaßnahmen und verhängte Zölle auf eine breite Palette von US-Waren, darunter Stahl und Aluminium sowie einige symbolträchtige US-Konsumgüter wie Bourbon-Whiskey, Harley-Davidson-Motorräder und Blue Jeans (sog. Anhang-I-Maßnahmen). Im Jahr 2020 fügte die EU weitere Maßnahmen hinzu (sog. Anhang-II-Maßnahmen). Bevor die Anhang-II-Maßnahmen in Kraft traten, vereinbarten die USA und die EU jedoch die Aussetzung ihrer jeweiligen Zölle im Gegenzug für ein Zollkontingentsystem, das die Ausfuhr von Stahl- und Aluminiumerzeugnissen begrenzt.
Als Reaktion auf die von US-Präsident Trump neu eingeführten Zölle gegen die EU kündigte die EU-Kommission nun an, dass sie die Anhang I- und Anhang II-Maßnahmen am 1. April 2025 wieder in Kraft treten lassen wird. Darüber hinaus kündigte sie weitere Gegenmaßnahmen an, die sich auf Waren im Wert von rund 18 Milliarden Euro beziehen werden. Die EU-Kommission kündigte außerdem an, dass sie diese zusätzlichen Maßnahmen auf die Verordnung (EU) Nr. 654/2014 (die „Handelsvergeltungsverordnung“) stützen wird.
Die Handelsvergeltungsverordnung legt Regeln und Verfahren zur Aussetzung von Zugeständnissen oder sonstigen Verpflichtungen aus internationalen Handelsübereinkünften fest, um auf Verstöße von Drittländern gegen internationale Handelsregeln zu reagieren (Art. 1 lit. a Handelsvergeltungsverordnung), oder um bei einer Änderung der den Waren oder Dienstleistungen aus der Union gewährten Behandlung in einer Weise, die die Interessen der Union berührt, Zugeständnisse oder sonstige Verpflichtungen in den Handelsbeziehungen zu Drittländern wieder ins Gleichgewicht zu bringen (Art. 1 lit. b Handelsvergeltungsverordnung). Zu diesem Zweck ermöglicht Art. 5 lit. a der Handelsvergeltungsverordnung die Aussetzung von Zollzugeständnissen und die Einführung neuer oder höherer Zölle.
Die EU-Kommission betrachtet die Wiedereinführung der US-Zölle durch US-Präsident Trump als Schutzmaßnahme („safeguard“) im Sinne von Art. 8 des WTO-Übereinkommens über Schutzmaßnahmen. Diese Einschätzung erlaubt gemäß Art. 3 lit. (c) der Handelsvergeltungsverordnung die Anwendung derselben. Es bestehen jedoch gewisse Zweifel bezüglich der Einschätzung der EU-Kommission. In dem Streitbeilegungsverfahren zwischen China, Norwegen, der Schweiz und der Türkei gegen die USA im Fall „United States - Certain Measures on Steel and Aluminium Products“ befand ein WTO-Panel, dass die US-Zölle nicht als Schutzmaßnahmen einzuordnen seien, da sie durch nationale Sicherheitsinteressen der USA motiviert sind. Die Entscheidung des Panels wurde „ins Leere“ angefochten und die EU war auch nicht Partei des Rechtsstreits - somit bleiben wichtige Fragen um die Einordnung der US-Maßnahmen weiterhin ungeklärt. Alternativ könnte sich die EU auch auf Art. 3 lit. d der Handelsvergeltungsverordnung berufen, der in Fällen nicht ausgeglichener Änderungen von Zugeständnissen oder Verpflichtungen eines WTO-Mitglieds gemäß Artikel XXVIII des GATT 1994 greift (siehe dazu hier).
Als Teil des Prozesses zur Umsetzung dieser zusätzlichen Maßnahmen hat die EU-Kommission eine zweiwöchige Konsultation der Interessengruppen in der EU eingeleitet. Ihr Ziel ist es, geeignete Produkte zu ermitteln, die in die neuen Maßnahmen aufgenommen werden können, und eine wirksame und angemessene Reaktion im Einklang mit den in Art. 4 Abs. 3 der Handelsvergeltungsverordnung aufgeführten Kriterien zu gewährleisten. Jeder, der von den US-Zöllen betroffen ist oder von den neuen EU-Maßnahmen betroffen sein könnte, kann sich noch bis zum 26. März 2025, 12:00 Uhr Brüsseler Zeit, an dem Aufruf der EU-Kommission beteiligen.
III. Ausblick: Weitere Optionen der EU?
Zusätzlich zu den im Rahmen der Handelsvergeltungsverordnung angekündigten Maßnahmen könnte sich die EU-Kommission auch auf die Verordnung (EU) 2023/2675 (das „Anti-Coercion-Instrument“ oder „ACI“) berufen. Das 2023 in Kraft getretene ACI erlaubt es der EU, Vergeltungsmaßnahmen gegen Drittländer zu ergreifen, die wirtschaftlichen Zwang gegen die EU oder einen ihrer Mitgliedstaaten anwenden, um die Einstellung, Änderung oder Annahme eines bestimmten Rechtsakts zu verhindern oder zu erwirken (Art. 2 Abs. 1 ACI). Das ACI bildet auch die Rechtsgrundlage dafür, neben der Einführung von Zöllen weitere Maßnahmen zu ergreifen, darunter solche, die sich auf den Transit von Waren beziehen, Maßnahmen, welche die Erbringung von Dienstleistungen und den Zugang ausländischer Investoren zur EU betreffen, Maßnahmen, die den Schutz von Rechten des geistigen Eigentums und deren Nutzung einschränken, Maßnahmen, die das Recht von Unternehmen aus Drittländern auf Teilnahme an öffentlichen Ausschreibungsverfahren einschränken, sowie Maßnahmen, die den Zugang von Banken und Versicherungen zu den Kapitalmärkten der Union und sonstigen Finanzdienstleistungen einschränken. Insbesondere Maßnahmen, die auf den Handel mit Dienstleistungen abzielen, könnten sich erheblich auf die USA auswirken, die im Handel mit Dienstleistungen, insbesondere digitalen Dienstleistungen, einen erheblichen Handelsbilanzüberschuss gegenüber der EU aufweisen.
Die EU könnte zudem beschließen, die US-Zölle vor der WTO anzugreifen. Bereits in der Vergangenheit hatte die EU ein Streitbeilegungsverfahren gegen die von US-Präsident Trump 2018 eingeführten Stahl- und Aluminiumzölle angestoßen, sich aber mit der Biden-Regierung im Jahr 2021 auf eine Verhandlungslösung geeinigt. Zwar könnte die EU im Rahmen der WTO-Streitbeilegungsvereinbarung („DSU“) eine Panelentscheidung erwirken, doch ein solches Vorgehen hätte erhebliche Nachteile: einerseits ist ein solches Verfahren sehr zeitaufwändig und würde mehrere Monate oder sogar Jahre dauern. Vor allem aber könnte die USA angesichts der Dysfunktionalität des WTO Appellate Body einfach ein Rechtsmittel „ins Leere“ gemäß Art. 17 DSU einlegen, wodurch eine endgültige Entscheidung über den Rechtsstreit in der Schwebe bliebe.
Über die Handelsmaßnahmen hinaus könnte die EU auch beschließen, große US-Tech-Firmen mit Hilfe der EU-Gesetze über digitale Dienste und über digitale Märkte ins Visier zu nehmen. Gegen Apple, Meta und andere Unternehmen laufen bereits Ermittlungen, die zu Geldbußen von bis zu 10 % des gesamten weltweiten Jahresumsatzes der Unternehmen führen können, im Falle wiederholter Verstöße sogar bis zu 20 %.
IV. Mit US-Präsident Trump scheint ein Deal stets möglich zu sein
Ein erneuter Handelskonflikt zwischen den USA und der EU würde unweigerlich beiden Seiten schaden, weshalb Verhandlungen sicherlich der richtige Weg sind. Die EU ist weiterhin bestrebt, die transatlantischen Wirtschaftsbeziehungen zu erhalten und einer weitere Eskalation der Situation entgegenzuwirken. Vor diesem Hintergrund betonte die EU-Kommissionspräsidentin Ursula von der Leyen am 12. März 2025, dass die EU an ernsthaften Verhandlungen interessiert ist und bereit ist, ihre Gegenmaßnahmen zurückzunehmen, sofern eine diplomatische Lösung erreicht werden kann. Da US-Präsident Trump für seinen Geschäftssinn bekannt ist, zeichnet sich die Möglichkeit eines konstruktiven Dialoges ab. Potenzielle Verhandlungspunkte könnten die Senkung der EU-Zölle auf Industriegüter, wie z. B. Autos - die derzeit bei 10 % im Vergleich zu 2,5 % in den USA liegen - und die Aussicht auf eine verstärkte Beschaffung von US-Militärgütern aus dem von der EU vorgeschlagenen, erheblich erweiterten Verteidigungshaushalt sein. In den kommenden Wochen wird sich zeigen, ob dieser Handelsstreit zu einem ausgewachsenen Handelskrieg eskaliert oder eine neue diplomatische Verständigung fördert. Für Unternehmen ist es in diesem sich dynamisch entwickelnden Umfeld unerlässlich, über die EU-Handelspolitik auf dem Laufenden zu bleiben, Schwachstellen in der Lieferkette zu bewerten und sich auf regulatorische Anpassungen vorzubereiten.
Wir möchten Christoph Priess für seinen Beitrag zu dieser Veröffentlichung danken.
Bestens
informiert
Jetzt unseren Newsletter abonnieren, um zu aktuellen Entwicklungen auf dem Laufenden zu bleiben.
Jetzt anmelden