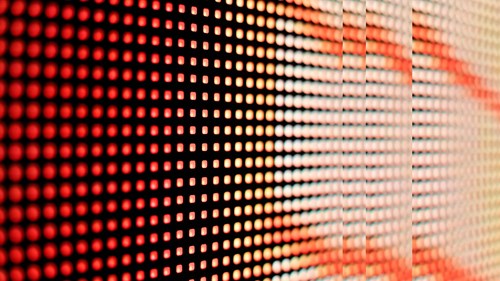EGMR entscheidet über drei „Klimaklagen“ – wegweisender Erfolg für zukünftige Klimaschutzklagen?
Der Europäische Gerichtshof für Menschenrechte (EGMR) in Straßburg hat darüber entschieden, ob Klimaschutz ein Menschenrecht ist und wer es einklagen kann. Drei Verfahren mit Klägern aus der Schweiz, Frankreich und Portugal standen zur Entscheidung an. Nur in einem Verfahren hat der EGMR der „Klimaklage“ stattgegeben – in seinem Urteil über die Klage der Schweizer „Klimaseniorinnen“. Die Entscheidung richtet sich nur an die Regierung der Schweiz. Es bleibt zu hoffen, dass sie auch in anderen Staaten zu einem Umdenken führt. In jedem Fall wird sie aber von NGOs und „Klimaklägern“, die mit Klagen gegen Staaten und Unternehmen für mehr Klimaschutz kämpfen, als wegweisender Erfolg gefeiert und als Argumentationshilfe herangezogen werden.
Die Abweisung der anderen beiden Verfahren gegen die Regierungen von insgesamt 32 Staaten macht indes deutlich, wie hoch die Schwelle für die Annahme einer Opfereigenschaft bei Klimaklagen liegt. Der große Durchbruch für den Klimaschutz sind die Urteile des EGMR daher wohl nicht. Jedenfalls sind sie ein Schritt hin zur Justiziabilität des Klimaschutzes gegenüber Staaten. Dies setzt aber voraus, dass sich geeignete Kläger durch den Instanzenzug des jeweiligen Staates gestritten haben.
„Klimaklage“ vor dem EGMR erfolgreich
Es ist das erste Mal, dass eine sog. „Klimaklage“ vor dem EGMR Erfolg hatte (Urteil vom 09.04.2024, Verein Klimaseniorinnen Schweiz and Others v. Switzerland, Application no. 53600/20).
Das Urteil ist aus zweierlei Gründen wegweisend: Zum einen hat der EGMR festgestellt, dass die Menschenrechte aus Art. 2 und Art. 8 der Europäischen Menschenrechtskonvention (EMRK) auch das Recht gewähren, durch staatliche Maßnahmen vor den Folgen des Klimawandels für Leben, Gesundheit und Wohlbefinden geschützt zu werden. Zum anderen hat der EGMR anerkannt, dass ein solches Begehren von einem Verband geltend gemacht werden kann.
In der Sache hatte sich das Gericht mit der Beschwerde einer Gruppe Seniorinnen und des Vereins „KlimaSeniorinnen Schweiz“ befasst: Diese hatten gegen die Schweiz Beschwerde erhoben und argumentiert, die Schweizer Behörden würden keine ausreichenden Maßnahmen ergreifen, um die Auswirkungen des Klimawandels auf die Lebensbedingungen und die Gesundheit – gerade besonders betroffener älterer Menschen – einzudämmen. Zuvor hatten sie erfolglos alle nationalen Instanzen in der Schweiz durchlaufen. Unterstützt und finanziert wurde die „Klimaklage“ von Greenpeace.
Der EGMR stellte fest, dass sich aus der EMRK ein Recht auf wirksamen Schutz durch staatliche Behörden vor den schwerwiegenden nachteiligen Auswirkungen des Klimawandels auf Leben, Gesundheit, Wohlbefinden und Lebensqualität ergebe. Die Schweiz sei ihren Pflichten nicht nachgekommen und habe so das Recht auf Privat- und Familienleben der „Klimaseniorinnen“ aus Art. 8 EMRK verletzt.
Ein wichtiger Streitpunkt in der Verhandlung war die Beschwerdebefugnis der Klägerinnen. Dabei geht es um die Frage der sog. Opfereigenschaft („victim-status criteria“, Art. 34 EMRK). Für die vier Einzelklägerinnen lehnte der EGMR diese Opfereigenschaft ab. Der EGMR machte damit deutlich, wie hoch die Schwelle für die Annahme einer Opfereigenschaft bei Klimaklagen liegt. Angesichts der unbestimmten Anzahl betroffener Personen sind sog. Popularbeschwerden zu vermeiden. Kurz gesagt bedeutet das: Kläger müssen ein eigenes Recht geltend machen, nicht ein Recht der Allgemeinheit. Ein Recht aus der EMRK kann daher nur geltend machen, wer von den Folgen des Klimawandels im besonderen Maße – etwa hinsichtlich der Dauer und der Schwere der Schäden oder durch eine besondere geografische Nähe – ausgesetzt ist.
Eine Beschwerdebefugnis des Vereins „Klimaseniorinnen Schweiz“ bejahte der EGMR indes, weil (i) die Organisation rechtmäßig in der Schweiz niedergelassen ist, (ii) der Verein die Menschenrechte seiner Mitglieder innerhalb der Schweiz verfolgt und (iii) nachweisen konnte, dass er diese Personen auch wirklich repräsentieren kann. Nach Ansicht des EGMR konnte der Verein daher auch im Namen der unmittelbaren Opfer des Klimawandels Beschwerde erheben. Der EGMR stärkt damit die Möglichkeit von Verbandsklagen im Bereich der Climate Disputes.
Interessant ist mit Blick auf zukünftige Verfahren zum Klimaschutz auch die weitere Begründung: Im Instanzenzug hätten die Schweizer Gerichte die Begründetheit der Klage nicht hinreichend geprüft. Insbesondere hätten sie die zwingenden wissenschaftlichen Erkenntnisse zum Klimawandel berücksichtigenmüssen. Der EGMR stellte deshalb eine Verletzung des Rechts auf ein faires Verfahren aus Art. 6 EMRK fest.
Zwei weitere „Klimaklagen“ als unzulässig abgewiesen
In den zwei weiteren Entscheidungen des EGMR vom 09.04.2024 wird sichtbar, dass trotz des Urteils gegen die Schweiz grundsätzlich hohe Hürden für „Klimaklagen“ gegen Staaten bestehen.
So scheiterte die Beschwerde des ehemaligen –Bürgermeisters einer nordfranzösischen Küstengemeinde gegen Frankreich an der erforderlichen Opfereigenschaft, weil der Bürgermeister mittlerweile nach Brüssel umgezogen war (Urteil vom 09.04.2024, Carême v. France, Application no. 7189/21).
Auch die „Klimaklage“ sechs junger Portugiesen gegen diverse europäische Länder (Duarte Agostinho and Others v. Portugal and 32 Others, Application no. 39371/20) wies der EGMR bereits als unzulässig ab. Die Kläger hatten neben allen Mitgliedsstaaten der Europäischen Union auch Norwegen, Großbritannien, die Türkei, die Schweiz und Russland verklagt. In ihrem Heimatland Portugal hatten sie jedoch den Rechtsweg nicht ausgeschöpft (Art. 35 EMRK). Die Beschwerde gegen die anderen Staaten wurde – ebenso wie die Klage des Bürgermeisters – abgewiesen, weil sie gegen Staaten gerichtet waren, in denen die Klägerin nicht lebten. Staaten müssen nach der Begründung des EGMR die Rechte der EMRK jedoch nur in ihrem eigenen Gebiet gewährleisten. Zwar könnten Menschenrechte ausnahmsweise auch extraterritorial angewendet werden. Hier aber nicht, weil sonst die staatliche extraterritoriale Verantwortung zu weit ginge.
Ist das Urteil gegen die Schweiz ein Präzedenzfall?
Das Urteil im Fall der „Klimaseniorinnen“ richtet sich zwar zunächst nur an die Schweiz. Es wird dennoch international rechtliche und politische Signalwirkung entfalten. Daher ist zu erwarten, dass Klimaschutz-NGOs in Europa und weltweit sich bestätigt fühlen und in weiteren Staaten Klagen einreichen werden. Allerdings hat der EGMR auch deutlich gemacht, dass Popularbeschwerden im Bereich Klimaschutz keine Aussicht auf Erfolg haben. Die Schwelle für die Annahme einer Opfereigenschaft – und damit der Beschwerdebefugnis – ist bei „Klimaklagen“ nach wie vor hoch.
In Deutschland werden die Auswirkungen des „Klimaseniorinnen“-Urteils begrenzt sein. Hier hat das Bundesverfassungsgericht bereits in seiner Entscheidung vom 21.03.2021 zum Klimaschutzgesetz auf Basis des deutschen Grundgesetzes festgestellt, dass der Staat geeignete Maßnahmen zur Einhaltung der Klimaschutzziele des Pariser Abkommens ergreifen muss. Es hat deshalb einen umfassenderen Klimaschutz des Gesetzgebers zur Sicherung zukünftiger Generationen angemahnt („Klima-Compliance“: Nach Bundesverfassungsgericht und Rechtbank Den Haag erhöht auch der EuGH den Handlungsdruck (noerr.com)). Der Gesetzgeber hat das Klimaschutzgesetz daraufhin nachgebessert. Eine darauffolgende weitere Klage hat das Bundesverfassungsgericht nicht mehr zur Entscheidung angenommen.
Dennoch ist zu erwarten, dass „Klimaklagen“ gegen Unternehmen durch das Urteil des EGMR auch in Deutschland wieder Aufwind erfahren. Gleichzeitig ist nicht ersichtlich, dass sich durch die Urteile des EGMR an der bisherigen Rechtsprechung der deutschen Zivilgerichte etwas ändern könnte. Deutsche Zivilgerichte haben „Klimaklagen“ auf Emissionsreduzierung gegen Unternehmen bisher zurückgewiesen (Weitere Klimaklagen abgewiesen – zum „E“ in ESG Litigation (noerr.com); Update „Klimaklagen“ – Erste Landgerichte halten „Klimaklagen“ für unbegründet (noerr.com); „Klimaklagen“ gegen deutsche Unternehmen unter der Lupe (noerr.com)). Die Begründung ist im Kern, dass allenfalls der Gesetzgeber zu mehr Anstrengungen im Bereich Klimaschutz verpflichtet ist. Dagegen ist es nicht die Aufgabe der Judikative, einzelne private Akteure zu Emissionseinsparungen zu verurteilen, die bisher nicht durch Gesetz oder Verordnung von ihnen gefordert werden.
Eine Entscheidung des Bundesgerichtshofs zu diesen Themen steht noch aus. Bis dahin werden „Klimakläger“ ihre Argumentation durch das „Klimaseniorinnen“-Urteil unterstützt sehen. Es bleibt also spannend im Bereich der Climate Disputes.
Kontakt
Share
Bestens
informiert
Jetzt unseren Newsletter abonnieren, um zu aktuellen Entwicklungen auf dem Laufenden zu bleiben.
Jetzt anmelden