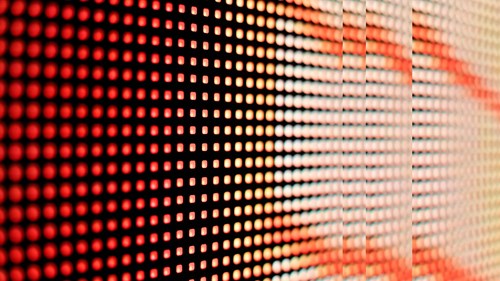Die Geschichte der Tablettenformmarke am Beispiel der Spalt-Tablette
Einleitung
Der vorliegende Beitrag behandelt die Entwicklung der Tablettenformmarke als Spielart der Warenformmarke. Da die vor allem in Deutschland bekannt gewordene Spalt-Tablette markenrechtlich gesehen eine Vorreiterrolle innehat, was den Schutz von Tablettenformmarken anbelangt, behandelt der Beitrag zunächst die Markenanmeldungen und -eintragungen im Hinblick auf die Spalt-Tablette, um sich dann den heute geltenden allgemeinen Grundsätzen der Schutzfähigkeit von Tablettenformmarken zuzuwenden. Schließlich werden auch andere Marken bzw. Markenanmeldungen beleuchtet und mit den dargestellten Grundsätzen abgeglichen. Der Beitrag zeigt auf, dass die Schutzfähigkeit von Tablettenformmarken Ende der 1990er Jahre eine Zäsur erfahren hat und der Schutz reiner Tablettenformmarken seit Anfang der 2000er Jahre erheblich schwerer zu erlangen ist. Es empfiehlt sich für den Schutz von Tablettenformmarken, der reinen Warenform weitere unterscheidungskräftige Merkmale hinzuzufügen, wobei es regelmäßig nicht ausreichen wird, die Tablette mit Einkerbungen zu versehen.
Die (markenrechtliche) Geschichte der Spalt-Tablette
„Sagense mal Meester, könn’se en Loch in ne Tablette machen, oder ne Kerbe oder sonst wat, det man im Dunkeln fühlen kann, wat es is“ – mit diesen seinem Tablettenmeister gegenüber geäußerten Worten soll der Geheimrat Leo Maximilian Baginski die Entwicklung der bekannten Spalt-Tablette in den 1930er Jahren angestoßen haben (Friedrich, Die Geschichte der Spalt-Tablette, Festschrift zum 75-jährigen Markenjubiläum, 1. Aufl. 2007, S. 28). Die Spalt-Tablette ist vor allem in Deutschland als Schmerzmittel gegen eine Vielzahl unterschiedlicher Arten von Schmerzen bekannt geworden und nimmt in der Geschichte der Tablettenformmarken eine Pionierrolle ein. Markenrechtlich betrachtet begann die Geschichte der Spalt-Tablette – und, soweit ersichtlich, mit ihr auch die Geschichte der Tablettenformmarke in Deutschland überhaupt – bereits am 20. Oktober 1931 mit der Anmeldung der deutschen Wort-/Bildmarke Nr. 441435. Die Marke, die bereits die Tablettenform mit ihrem typischen Spalt als Bild in einer weiter ausgestalteten Ellipse zeigt, wurde am 15. Januar 1932 u.a. für Arzneimittel und kosmetische Mittel eingetragen.
Die folgenden Marken, mit denen der Hersteller seine Spalt-Tabletten (und später auch die neu erdachten „Doppelspalt“-Tabletten) abzusichern suchte, entwickelten sich schnell in eine modernere Richtung, behielten aber den Fokus auf die Tablettenform bei. Die deutsche Wort-/Bildmarke Nr. 00714345, die im Jahr 1957 angemeldet wurde, steht bis heute für Arzneimittel in Kraft. 1962 wurde sodann die deutsche Wort-/Bildmarke Nr. 00762301 eingetragen, die ebenfalls bis heute Schutz genießt. Sie weist eine weiter reduzierte Darstellung der Spalt-Tablette auf, die neben einem Pfeil nur noch das Wortelement „Brausende Spalt“ enthält. Im Jahr 1981 wurde die deutsche Wort-/Bildmarke Nr. 00886657 eingetragen. Auch diese im Vergleich zu der ersten Anmeldung schon deutlich modernisierte Marke steht nach wie vor in Kraft. Dasselbe Zeichen wurde im Jahr 1972 als internationale Registrierung hinterlegt (Nr. 00385074) und im Jahr 1999 überdies als Gemeinschaftsmarke u.a. für pharmazeutische Erzeugnisse und Substanzen in Klasse 5 eingetragen (Nr. 00716258).
In den 1990er Jahren begann der Hersteller damit, die Form der Spalt- bzw. Doppelspalt-Tablette als Teil der Verpackungsgestaltung für Arzneimittel schützen zu lassen. Die deutsche Wort-/Bildmarke Nr. 2085022 wurde im Jahr 1994 eingetragen. Im Jahr 2000 wurde eine visuell deutlich reduziertere Packung für Doppel-Spalt als deutsche Wort-/Bildmarke Nr. 30025194 geschützt. Diese Entwicklung setzte sich fort mit der im Jahr 2001 erfolgten Eintragung der deutschen Wort-/Bildmarke Nr. 30051251, die neben der Abbildung der Tablette praktisch nur noch den Spalt-Schriftzug und einen blauen Hintergrund aufwies.
In der zweiten Hälfte der 1990er Jahren begann man überdies damit, Abbildungen der Spalt-Tablette aus unterschiedlichen Perspektiven als 3D-Marken für Arzneimittel schützen zu lassen. Die deutsche 3D-Marke Nr. 39753262 wurde 1998 eingetragen. Auch die sich von dieser Marke nur durch den Aufdruck „Spalt“ unterscheidende deutsche 3D-Marke Nr. 39753263 wurde im Jahr 1998 in das Register eingetragen. Der Hersteller versuchte, diese Eintragungspraxis Anfang der 2000er Jahre auszuweiten. Die Anmeldung der deutschen Bildmarke Nr. 39927583, die eine unbeschriftete Doppelspalt-Tablette zeigt, wurde im Jahr 2003 (möglicherweise wegen der Ankündigung einer negativen Antragsbescheidung) aber zurückgenommen. Das Zeichen hingegen, welches ein auf der Doppelspalt-Tablette eingeprägtes „DS“ aufweist, wurde im Jahr 2000 als deutsche 3D-Marke Nr. 39927584 eingetragen.
Allgemeine Grundsätze zur Schutzfähigkeit
Tablettenformmarken als Unterfall der allgemeinen Warenformmarken sind grundsätzlich markenfähig. Das gilt unabhängig davon, ob sie zwei- oder dreidimensional dargestellt sind. Voraussetzung der Schutzfähigkeit ist aber, dass das angemeldete Zeichen, sofern es sich nicht schon im Verkehr als Herkunftshinweis durchgesetzt hat, die erforderliche Unterscheidungskraft aufweist (vgl. § 8 Abs. 2 Nr. 1 MarkenG bzw. Art. 7 Abs. 1 lit. b) der Gemeinschaftsmarkenverordnung, GMV). Überdies darf der Eintragung der Marke kein Freihaltebedürfnis der Mitbewerber entgegenstehen (vgl. § 8 Abs. 2 Nr. 2 MarkenG bzw. Art. 7 Abs. 1 lit. c) GMV).
Unterscheidungskraft ist die einer Marke innewohnende konkrete Eignung, vom Verkehr als Unterscheidungsmittel für die von der Marke erfassten Produkte eines Unternehmens gegenüber den Produkten anderer Unternehmen aufgefasst zu werden (EuGH GRUR 2010, 228 Rn. 33 – Audi/HABM [Vorsprung durch Technik]; BGH GRUR 2015, 1012 Rn. 10 – Nivea-Blau; BGH GRUR 2015, 581 Rn. 9 – Langenscheidt-Gelb; BGH GRUR 2013, 731 Rn. 11 – Kaleido). Denn Hauptfunktion der Marke ist es, auf die Herkunft der gekennzeichneten Waren oder Dienstleistungen hinzuweisen. Bei der Beurteilung der Unterscheidungskraft ist dabei grundsätzlich von einem großzügigen Maßstab auszugehen. Jede auch noch so geringe Unterscheidungskraft reicht aus, um das Schutzhindernis zu überwinden (BGH GRUR 2015, 1012 Rn. 10 – Nivea-Blau; BGH GRUR 2015, 581 Rn. 9 – Langenscheidt-Gelb; BGH GRUR 2014, 872 Rn. 12 – Gute Laune Drops; BGH GRUR 2010, 1100 Rn. 10 – TOOOR).
Diese Grundsätze finden auch bei der Beurteilung der Unterscheidungskraft von Warenformmarken Anwendung. Bei ihnen ist zwar grundsätzlich kein strengerer Maßstab anzulegen als bei herkömmlichen Markenformen (BGH GRUR 2006, 679 Rn. 16 – Porsche Boxster; BPatG, Beschluss vom 26.11.2015, Az. 25 W (pat) 532/13), so dass es für die Unterscheidungskraft wie bei jeder anderen Markenform allein darauf ankommt, ob der Verkehr in dem angemeldeten Zeichen für die in Rede stehenden Waren oder Dienstleistungen einen Herkunftshinweis sieht (EuGH GRUR 2003, 514 Rn. 41 f., 46 – Linde, Winward und Rado; BGH GRUR Int. 2001, 462, 463f. - Stabtaschenlampe). Nach der Rechtsprechung sowohl des EuGH als auch des BGH sind bei Warenformmarken allerdings wesentliche Unterschiede gegenüber „klassischen“ Wort- oder Bildmarken zu beachten. Die Rechtsprechung geht davon aus, dass Warenformmarken tatsächlich nicht in gleicher Weise wie Wort- oder Bildmarken aufgefasst werden, weil sowohl der Durchschnittsverbraucher als auch die Fachkreise aus der Form der Ware oder deren Verpackung gewöhnlich nicht auf die betriebliche Herkunft dieser Waren schließen (EuGH GRUR 2012, 610 Rn. 46 – Freixenet; EuGH GRUR 2006, 233 Rn. 31 – Standbeutel; EuGH GRUR 2006, 1022 Rn. 27 – Wicklerform). Der EuGH hat dabei den Grundsatz geprägt, dass bei dieser Markenform ein „bloßes Abweichen“ von der Norm oder Branchenüblichkeit noch keine Unterscheidungskraft begründet. Die Marke könne die erforderliche Herkunftsfunktion nur dann erfüllen, wenn sie von Norm oder Branchenüblichkeit erheblich abweiche (EuGH GRUR Int. 2006, 842 Rn. 26 – Form eines Bonbons II; EuGH GRUR Int. 2006, 226 Rn. 31 – Standbeutel; EuGH GRUR Int. 2005, 135 Rn. 31 – Maglite; EuGH GRUR Int. 2004, 639 Rn. 37 – Dreidimensionale Tablettenform III; EuGH GRUR Int. 2004, 635 Rn. 37 – Dreidimensionale Tablettenform II; EuGH GRUR Int. 2004, 631 Rn. 39 – Dreidimensionale Tablettenform I; EuGH GRUR 2004, 428 Rn. 49 – Henkel; EuG GRUR Int. 2013, 641 Rn. 21 – Adelholzener; siehe auch BGH GRUR 2004, 507, 509 – Transformatorengehäuse; BGH GRUR 2004, 329, 330 – Käse in Blütenform). Solche Abweichungen müssen vom Verkehr ohne besondere Aufmerksamkeit, analysierende und vergleichende Betrachtung oder nähere Prüfung zu erkennen sein (vgl. nur EuGH GRUR Int. 2004, 639 Rn. 36 ff. – Dreidimensionale Tablettenform III). Dementsprechend gilt sowohl bei zweidimensionalen Marken, die sich in der bloßen Abbildung der Ware erschöpfen, als auch bei dreidimensionalen Marken, die die Form der Ware darstellen, dass solchen Marken trotz Anlegung des beschriebenen großzügigen Prüfungsmaßstabs im Allgemeinen die erforderliche konkrete Unterscheidungskraft fehlt.
Der Eintragung einer Marke, die aus der Warenform besteht, kann überdies das Interesse der Allgemeinheit an der Freihaltung der beanspruchten Form entgegenstehen, wenn sie funktionsbedingt ist (vgl. § 8 Abs. 2 Nr. 2 MarkenG bzw. Art. 7 Abs. 1 lit. c) GMV). Für Tablettenformmarken bedeutet dies, dass solchen Zeichen, die sich in der Tablettenform erschöpfen und lediglich Einkerbungen zum leichteren Durchteilen der Tabletten aufweisen, regelmäßig (auch) ein Freihaltebedürfnis entgegensteht.
Freilich bleibt es neben den vorstehenden Grundsätzen dabei, dass ein Markenschutz an der Tablettenform in Deutschland jedenfalls grundsätzlich auch durch die Erlangung von Verkehrsgeltung nach § 4 Nr. 2 MarkenG entstehen kann. Soweit ersichtlich, ist ein solcher Schutz von den Gerichten jedoch bislang nicht angenommen worden. Daneben kann eine Verkehrsdurchsetzung (§ 8 Abs. 3 MarkenG) bzw. eine erlangte Unterscheidungskraft (Art. 7 Abs. 3 GMV) zum Schutz der Tablettenform führen. Dies wird aber lediglich in besonderen Ausnahmefällen denkbar sein. So wurde die im Jahr 1999 angemeldete Gemeinschaftsbildmarke Nr. 1275064 im Jahr 2001 kraft erlangter Unterscheidungskraft für Antidepressiva eingetragen.
Analyse der Spalt-Marken
Im Einklang mit diesen Feststellungen steht zunächst, dass die vorstehend dargestellten, mit einem unterscheidungskräftigen Wort- und/oder Bildbestandteil versehenen Spalt-Tablettenformmarken allesamt eingetragen wurden. Beim Aufdruck der Produktmarke oder des Firmenlogos auf die Tablette ist der unterscheidungskräftige Bestandteil nämlich regelmäßig nur die Produktmarke bzw. das Firmenlogo (Fuhrmann/Klein/Fleischfresser, Arzneimittelrecht, 2. Aufl. 2014, § 30 Rn. 19).
Ebenfalls in Einklang mit den dargestellten Grundsätzen steht ferner, dass die unbeschriftete Doppelspalt-Tablette wohl als nicht schutzfähig angesehen wurde. Überraschend hingegen erscheint die 1998 erfolgte Eintragung der unbeschrifteten Spalt-Tablette. Die Eintragung lässt sich jedoch damit erklären, dass sich die Rechtsprechung erst seit Anfang der 2000er Jahre intensiv mit der Schutzfähigkeit von Warenformmarken beschäftigt und die vorstehenden Grundsätze im Einzelnen entwickelt hat.
Betrachtung weiterer Tablettenformmarken
Auch eine Betrachtung von weiteren Markenanmeldungen, die Tablettenformen betreffen, fügt sich ohne weiteres in das zuvor aufgezeichnete Gesamtbild ein. Es ist anhand der Eintragungspraxis der Markenämter klar zu erkennen, dass es in den 1990er Jahren erheblich leichter war, Schutz für eine Tablettenformmarke zu erlangen. In dieser Zeit wurden lediglich ganz gängige Formen als schutzunfähig abgelehnt. Etwa seit Beginn der 2000er Jahre sind die Anforderungen an eine Schutzfähigkeit deutlich angestiegen. Wer seither noch Schutz für seine Tablettenformmarke begehrt, erhält diesen nahezu ausschließlich noch über den Zusatz weiterer unterscheidungskräftiger Merkmale.
Die 1990er Jahre
Das Register weist eine Reihe von Marken aus, die in den 1990er Jahren angemeldet und als schutzfähig beurteilt wurden. Lediglich ganz „simple“ Formen wurden auch in dieser Zeit schon als schutzunfähig zurückgewiesen (vgl. z.B. die deutschen Marken Nr. 39823107, Nr. 39855919, Nr. 39850852 und Nr. 39538089).
Wenn und soweit die angemeldeten Marken von dem üblichen Formenschatz bei Tabletten – und sei es nur durch besondere Einkerbungen – abwichen, wurden sie hingegen vielfach als Warenformmarke eingetragen (vgl. z.B. die deutschen Marken Nr. 39610784, Nr. 39610785, Nr. 39648521, Nr. 39835823sowie die Gemeinschaftsmarke Nr. 366013).
Die im Jahr 1999 angemeldete deutsche 3D-Marke Nr. 39410360 wurde zwar zunächst als nicht unterscheidungskräftig zurückgewiesen, auf die Beschwerde der Markeninhaberin dann aber doch für eintragungsfähig befunden (vgl. BPatG, Beschluss vom 11.05.2001, Az. 30 W (pat) 27/00). Das BPatG führte in seiner Entscheidung aus, dass die angemeldete Tablette in mehreren Merkmalen von der typischen Form von Tabletten abweiche, weil ihre Form auf den ersten Blick völlig unregelmäßig, gleichsam willkürlich erscheine und erst bei näherer Betrachtung eine gewisse Symmetrie erkennbar werde. Eine technische Funktion der Formgestaltung sei nicht zu erkennen. Das BPatG zog zur Begründung seiner Auffassung zudem das den Fachkreisen zur Verfügung stehende Nachschlagewerk „Gelbe Liste IDENTA“ heran, in dem die angemeldete Marke unter „Sonderformen“ eingeordnet war. Dies wertete das BPatG als Indiz dafür, dass zumindest der Fachverkehr in der Marke eine charakteristische untypische Gestaltung erblicke.
Die oben aufgeführten von den Markenämtern akzeptierten Zeichen würden bei heutiger Anmeldung aller Voraussicht nach nicht mehr als schutzfähig beurteilt werden. Mit dieser Einschätzung in Einklang steht, dass die deutsche Bildmarke Nr. 39720885 , die im Jahr 1997 für Antidepressiva in Klasse 5 eingetragen wurde, den gegen sie gerichteten Löschungsangriff nicht überstanden hat und im Jahr 2004 wegen absoluter Schutzhindernisse für nichtig erklärt wurde (vgl. BGH GRUR 2004, 683 – Farbige Arzneimittelkapsel).
Die 2000er Jahre
Mit Beginn der 2000er Jahre zeigt das Register eine ganze Reihe von „nackten“ Tablettenformmarken, die vor allem wegen fehlender Unterscheidungskraft zurückgewiesen wurden. Beispiele aus dem deutschen Register sind die Anmeldungen Nr. 39741395, Nr. 39741396, Nr. 39836025, Nr. 39836027 und Nr. 39836028. Auch die Anmeldung der deutschen Bildmarke Nr. 39953953 wurde im Jahr 2003 durch Beschluss des BPatG (Beschluss vom 28.04.2003, Az. 30 W (pat) 93/02) als „naturgetreue Abbildung einer Arzneimittelkapsel“ mangels Unterscheidungskraft zurückgewiesen.
Die Eintragungspraxis des HABM war ähnlich streng. So wurde beispielsweise die u.a. für pharmazeutische Erzeugnisse angemeldete Gemeinschaftsmarke Nr. 03404878 aus dem Jahr 2003 zurückgenommen, nachdem das HABM die Markenanmeldung für die entscheidenden Waren in Klasse 5 zurückgewiesen hatte. Das HABM sprach dem Zeichen die notwendige Unterscheidungskraft ab, weil es nicht erheblich von der Norm oder Branchenüblichkeit abweiche. Die „Herzform“ erscheine nicht sehr ausgeprägt, sondern sei eher als abgerundete Form einzustufen. Die Einkerbungen seien weder ungewöhnlich noch auffällig. Beide Merkmale würden zudem bestimmte Funktionen erfüllen. Die abgerundete Form erleichtere das Herunterschlucken, die Einkerbung die Teilung der Tablette. An seine Voreintragung der Gemeinschaftsbildmarke fühlte sich das Amt nicht gebunden.
Sobald den Formmarken allerdings eine unterscheidungskräftige Aufschrift hinzugefügt wurde, wurden die Marken hingegen eingetragen. Ein gutes Beispiele hierfür ist die deutschen Marke Nr. 39958388. Weitere Beispiele sind die deutsche Wort-/Bildmarke Nr. 30644757, die im Jahr 2006 für homöopathische Arzneimittel in Klasse 5 angemeldet und eingetragen ist, sowie die deutsche 3D-Marke Nr. 30707763, die im Jahr 2007 für Arzneimittel in Klasse 5 akzeptiert wurde.
Fazit
Als Ergebnis dieser Betrachtungen lässt sich festhalten, dass die Schutzfähigkeit von Tablettenformmarken gegen Ende der 1990er Jahre eine Zäsur erfahren hat. Seit Beginn der 2000er Jahre sind jedenfalls „nackte“ Tablettenformmarken kaum mehr als markenrechtlich schutzfähig beurteilt worden. Auch eine ungewöhnliche Form der Tablette kann ihr angesichts des inzwischen auf dem Markt verfügbaren reichen Formenschatzes nicht mehr zu einer Eintragungsfähigkeit verhelfen. Gleichermaßen sind Einkerbungen regelmäßig nicht geeignet, der Tablettenform die erforderliche Unterscheidungskraft zu verleihen. Wegen der durch die Einkerbung erzielten leichteren Teilbarkeit der Tablette sehen sich solche Zeichen zudem regelmäßig dem Einwand des Freihaltebedürfnisses ausgesetzt. Der sicherste Weg, eine Tablettenformmarke zu schützen, dürfte daher derjenige über eine Wort- oder Buchstabenkennzeichnung sein – Spalt und Doppelspalt lassen grüßen. Alternativ kann die Tablettenform mit einer unterscheidungskräftigen Verpackungsgestaltung kombiniert werden. Auch hier hat man bei der Spalt-Tablette und ihrer separat unter Markenschutz gestellten Umverpackung alles richtig gemacht.

Bestens
informiert
Jetzt unseren Newsletter abonnieren, um zu aktuellen Entwicklungen auf dem Laufenden zu bleiben.
Jetzt anmelden