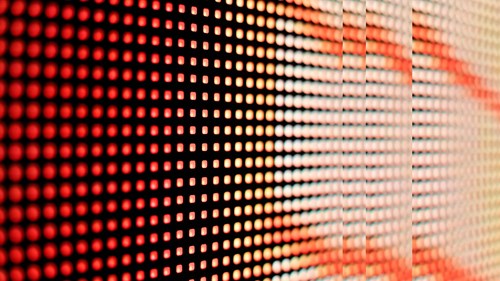Sticking to the plan: Das 16. Sanktionspaket der EU zum dritten Jahrestag des russischen Überfalls auf die Ukraine
Hintergrund
Selbst angesichts der weltweiten politischen Spannungen und der Ungewissheit über die Zukunft und die Wirksamkeit der Russland-Sanktionen der EU unter der zweiten Trump-Regierung ließ sich die polnische EU-Ratspräsidentschaft nicht beirren und hält an der vergleichsweise strengen EU-Sanktionspolitik gegenüber Russland fest.
Zum dritten Mal in Folge nahm der Rat den Jahrestag des russischen Überfalls auf die Ukraine zum Anlass, ein neues Sanktionspaket zu verabschieden. Am 24. Februar veröffentlichte die EU mit der Verordnung (EU) 2025/395 des Rates zur Änderung der Verordnung (EU) Nr. 833/2014 und der Verordnung (EU) 2025/390 des Rates sowie der Durchführungsverordnung (EU) 2025/389 des Rates zur Änderung der Verordnung (EU) Nr. 269/2014 ihr 16. Sanktionspaket.[1]
Gleichzeitig führte die EU auch neue Sanktionen gegen Belarus ein, welche die gegen Russland verhängten Sanktionen zum ersten Mal unmittelbar widerspiegeln. Diese Maßnahmen wurden durch die Verordnung (EU) 2025/392 des Rates und die Durchführungsverordnung (EU) 2025/386 des Rates zur Änderung der Verordnung (EG) Nr. 765/2006 eingeführt.
Wie erwartet, konzentriert sich das 16. Sanktionspaket auf die Bekämpfung von Umgehungspraktiken, insbesondere durch die "Schattenflotte" Russlands, und bringt neue Handelsbeschränkungen mit sich, darunter ein Einfuhrverbot für russisches Aluminium. Darüber hinaus werden sektorspezifische Maßnahmen erlassen, die auf Russlands Energie-, Infrastruktur- und Finanzdienstleistungssektor abzielen. Auch wenn das neue Paket angesichts der laufenden internationalen politischen Veränderungen vorhersehbar erscheint, ist es dennoch das Ergebnis langer und bisweilen kontroverser Verhandlungen unter den EU-Mitgliedstaaten.
Kontroverse Verhandlungen über LNG-Einfuhrbeschränkungen
Insgesamt war der Weg zum jüngsten Sanktionspaket durchaus steinig. Viele Beobachter rechneten damit, dass das 16. Sanktionspaket zumindest ein teilweises Einfuhrverbot für russisches LNG enthalten würde. Im Dezember 2024 drängten zehn skandinavische und osteuropäische EU-Mitgliedstaaten Berichten zufolge auf ein solches teilweises oder vollständiges Verbot russischer LNG-Importe. Während diese Länder selbst nicht auf russisches LNG angewiesen sind, hängen andere Mitgliedstaaten wie Spanien, Frankreich und Belgien stark davon ab. Andere EU Mitgliedstaaten, wie Deutschland, profitieren vom LNG-Handel mit diesen Importländern. Aufgrund des Einflusses dieser Mitgliedstaaten wurden die LNG-Importbeschränkungen schließlich vor Beginn der letzten Verhandlungsrunden weitgehend ad acta gelegt. Einzig ein Verbot russischer LNG-Lieferungen an EU-Terminals, die nicht an das Erdgasverbundsystem angeschlossen sind, konnte in das Paket aufgenommen werden. Diese Einschränkung wird jedoch die meisten russischen LNG-Einfuhren unberührt lassen.
Inhalt des 16. Sanktionspakets: Bekämpfung von Umgehungspraktiken, Handelsbeschränkungen und neue Listungen
Das 16. Sanktionspaket befasst sich mit einem breiten Spektrum verschiedener Themen und baut auf früheren Sanktionspaketen auf. Zu den wichtigsten Änderungen der EU-Sanktionsregelung gegen Russland gehören die folgenden:
- Anti-Umgehungmaßnahmen: Das neue Sanktionspaket befasst sich erneut mit Russlands „Schattenflotte“, die bereits im Rahmen des 15. Sanktionspakets im Fokus stand. 74 weitere Schiffe wurden in Anhang XLII der Verordnung (EU) Nr. 833/2014 aufgenommen. Alle aufgelisteten Schiffe dürfen keine EU-Häfen mehr anlaufen. Auch ist es natürlichen und juristischen Personen aus der EU untersagt, eine Vielzahl von Dienstleistungen zu erbringen, z. B. Dienstleistungen im Seeverkehr gemäß Artikel 3s der Verordnung (EU) Nr. 833/2014. Da die „Schattenflotte“ insbesondere mit Blick auf die Umwelt und Sicherheit im Seeverkehr Gefahren mit sich bringt, enthält das neue Sanktionspaket auch ein zusätzliches Kriterium für die Aufnahme solcher unsicheren Schiffe in die Liste.
- Einfuhrverbot für russisches Aluminium: Die EU hat außerdem umfassende Einfuhrbeschränkungen für russisches Primäraluminium eingeführt. Das Verbot ist mit einer einjährigen Übergangsfrist verbunden. Während dieser Zeit gilt ein Quotenmechanismus, der es EU-Wirtschaftsakteuren erlaubt, insgesamt 270.000 Tonnen Aluminium in die EU einzuführen, was immer noch 80 % der EU-Einfuhren im Jahr 2024 entspricht. Nach Ablauf der Übergangsfrist sind Einfuhren von russischem Aluminium vollständig verboten.
- Ausweitung der Exportbeschränkungen: Das Paket zielt darauf ab, die Ausfuhr von Gütern und Technologien mit doppeltem Verwendungszweck, die vom russischen Militär im Krieg gegen die Ukraine eingesetzt werden, weiter zu beschränken. Dazu gehören Güter wie Videospielgeräte und Flugsimulatoren, die Russland zur Unterstützung seiner Drohnenoperationen auf dem Gefechtsfeld einsetzt. Darüber hinaus wurden chemische Grundstoffe für Reizstoffe (riot control agents), Software im Zusammenhang mit numerisch gesteuerten Werkzeugmaschinen (CNC-Maschinen) und Chromverbindungen in die Liste der sanktionierten Güter aufgenommen – ebenso wie Chemikalien, Mineralien, Glas und Feuerwerkskörper.
- Energiepolitische Maßnahmen: Neu eingeführte Beschränkungen verbieten es EU-Unternehmen nunmehr, Software für die Öl- und Gasexploration zu liefern. Darüber hinaus wurde auch ein Verbot von Waren, Technologien und Dienstleistungen für Erdölprojekte in Russland eingeführt. Mit diesen Maßnahmen sollen die russischen Gewinne aus dem Ölverkauf und dem -transport eingedämmt werden. Darüber hinaus wurde mit dem Paket ein Verbot eingeführt, russisches Rohöl und Erdölerzeugnisse in der EU vorübergehend zu verwahren oder in das Freizonenverfahren zu überführen. Im Zuge dieser energiepolitischen Maßnahmen erließ die EU auch erhebliche Beschränkungen für direkte und indirekte Transaktionen mit bestimmten aufgelisteten Häfen, Schleusen und Flughäfen, die von Russland in der Vergangenheit zur Umgehung der EU-Sanktionen, insbesondere der G7-Ölpreisobergrenze, genutzt wurden.
- Verbot der Übertragung von IP-Rechten an Unternehmenssoftware: Die EU stellt ferner klar, dass sich das Verbot des Verkaufs, der Lieferung, der Weitergabe, der Ausfuhr oder der Bereitstellung von Software für die Unternehmensführung und von Software für Industriedesign und Fertigung an juristische Personen in Russland auch auf den Verkauf, die Lizenzierung oder die sonstige Weitergabe von Rechten des geistigen Eigentums oder von Geschäftsgeheimnissen im Zusammenhang mit dieser Software erstreckt.
- Infrastrukturmaßnahmen: Das neue Sanktionspaket der EU sieht ein umfassendes Transaktionsverbot für bestimmte Bereiche der russischen Infrastruktur vor, darunter wichtige Flughäfen und Häfen wie Vnukovo und Zhukovsky in Moskau sowie die Seehäfen Ust-Luga, Primorsk und Novorossiysk. Darüber hinaus wurden Bauleistungen in die Liste der Dienstleistungen aufgenommen, deren Erbringung EU-Unternehmen verboten ist.
- Verschärfung des Verbots des Straßentransports von Gütern: Die EU-Mitgliedstaaten haben sich ebenfalls darauf geeinigt, das Verbot des Straßentransports von Waren innerhalb der EU zu ändern, um Schlupflöcher zu schließen. Unternehmen, die sich vor dem 8. April 2022 in der EU niedergelassen haben, ist es nun untersagt, ihre Kapitalstruktur so zu ändern, dass der prozentuale Anteil einer russischen Beteiligung auf 25 % oder mehr steigt.
- Neue gerichtliche Notzuständigkeit: Mit dem 14. EU-Sanktionspaket wurden die Artikel 11a und 11b der Verordnung (EU) Nr. 833/2014 eingeführt, die es EU-Unternehmen ermöglichen, vor den Gerichten der EU-Mitgliedstaaten Schadenersatz für bestimmte Schäden zu verlangen, die durch die Geltendmachung von Forderungen russischer Einrichtungen gegen sie vor Gerichten in Drittländern oder durch Entscheidungen im Rahmen bestimmter russischer Erlasse oder Rechtsvorschriften entstanden sind. Das neue Sanktionspaket ergänzt diese beiden Bestimmungen, indem es in Artikel 11d der Verordnung (EU) Nr. 833/2014 ein sogenanntes "forum necessitates" schafft, das es Gerichten in EU-Mitgliedstaaten ausnahmsweise ermöglicht, über einen solchen Schadensersatzanspruch zu entscheiden, wenn das EU-Recht oder das Recht eines EU-Mitgliedstaats keine Zuständigkeit eines bestimmten Gerichts eines EU-Mitgliedstaats begründet.
- Neue Listungen: Ein wesentliches Merkmal jedes Sanktionspakets ist die Erweiterung der Liste von sanktionierten Einzelpersonen, Organisationen und Einrichtungen. Mit dem 16. Sanktionspaket werden 48 natürliche und 35 juristische Personen neu hinzugefügt, die nun Vermögenssperren unterliegen. Darüber hinaus wurden gegenüber 53 Unternehmen gezielte Ausfuhrbeschränkungen verhängt, da sie den militärisch-industriellen Komplex Russlands in seinem Krieg gegen die Ukraine unterstützen.
Wie bereits erwähnt, enthält das 16. Sanktionspaket auch Neuerungen in Bezug auf das Belarus-Sanktionsregime welche die Änderungen und Ergänzungen der Russland-Sanktionen spiegeln und gleichen die Maßnahmen gegen Belarus an, um eUmgehung effektiv entgegenzuwriken.
Ausblick
Das 16. Sanktionspaket umfasst erneut ein breites Spektrum von Bereichen, wobei zahlreiche Aktualisierungen bestehende Maßnahmen schärfen oder erweitern. Dennoch erfordern diese jüngsten Änderungen eine gründliche Prüfung – der Teufel steckt bekanntlich im Detail. Insgesamt vermittelt das Paket die politische Botschaft, dass die EU trotz der signifikanten Veränderungen in der US-Außenpolitik entschlossen ist, ihre harte Haltung gegenüber Russland aufrechtzuerhalten. Während diese Haltung beachtenswert ist, bleibt die Wirksamkeit der aktuellen EU-Sanktionspolitik sowohl gegenüber Russland als auch gegenüber Belarus ungewiss, insbesondere vor dem Hintergrund der laufenden Verhandlungen der USA mit Russland.
[1] Darüber hinaus wurden weitere Änderungen in Bezug auf die spezifischen Sanktionsregime zu den nicht von der Regierung kontrollierten ukrainischen Gebieten vorgenommen, siehe Verordnung (EU) 2025/398 des Rates und Verordnung (EU) 2025/401 des Rates.
Bestens
informiert
Jetzt unseren Newsletter abonnieren, um zu aktuellen Entwicklungen auf dem Laufenden zu bleiben.
Jetzt anmelden