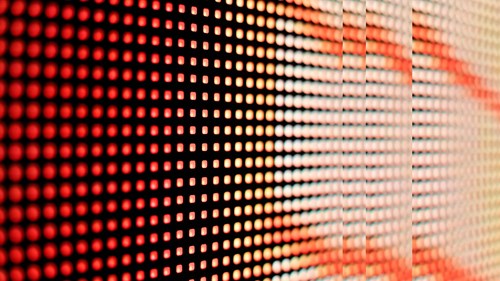Selektiver Vertrieb: Verbot von Preisvergleichsportalen kartellrechtswidrig
Die Entscheidung
Das OLG Düsseldorf hat im Anschluss an die mündliche Verhandlung am 05.04.2017 die sog. ASICS-Entscheidung des Bundeskartellamtes bestätigt.
Das Bundeskartellamt hatte in seiner Entscheidung vom 26.08.2015 festgestellt, dass einige Einschränkungen des Online-Vertriebs, die der Laufschuhhersteller ASICS seinen in einem selektiven Vertriebssystem organisierten deutschen Vertragshändlern auferlegt hatte, gegen das Kartellverbot in Art. 101 Abs. 1 AEUV und § 1 GWB verstießen (wir berichteten). Hierzu gehörte insbesondere auch das Verbot, Preisvergleichsportalen Schnittstellen zur Verfügung zu stellen, über welches diese Preis- und Produktdaten abrufen können. Die Nutzung von Preisvergleichsportalen durch die betroffenen Händler war damit ausgeschlossen.
Die gegen die Entscheidung des Bundeskartellamtes gerichtete Beschwerde von ASICS hat das OLG Düsseldorf zurückgewiesen. Ebenso wie das Bundeskartellamt kam das OLG Düsseldorf zu dem Ergebnis, dass es sich bei dem Verbot um eine nicht gerechtfertigte Kernbeschränkung des Internetvertriebs handelte. Eine Reihe von Gegenargumenten ließ das Gericht nach den Ausführungen in der mündlichen Verhandlung (die Urteilsgründe liegen noch nicht vor) nicht gelten. Insbesondere sei ein vollständiges Verbot der Nutzung von Preisvergleichsportalen weder erforderlich, um eine ordnungsgemäße Beratung des Kunden im Fachhandel sicherzustellen, noch mache der Schutz des Markenimages ein solches Verbot nötig. Zudem scheide eine Gruppenfreistellung nach der Vertikal-Gruppenfreistellungsverordnung 330/2010 aus, da ein generelles Verbot der Nutzung von Preisvergleichsportalen gegen Art. 4 lit. c) Vertikal-GVO verstoße. Es komme insoweit nicht darauf an, ob es sich um eine wesentliche Beeinträchtigung des passiven Internetvertriebs handele oder nicht.
Fazit und Ausblick
Die konkrete Frage des generellen Verbots der Nutzung von Preisvergleichsportalen scheint damit vorläufig geklärt. Gleichzeitig bleiben aber weitere aktuelle kartellrechtliche Probleme des Internetvertriebs nach der Entscheidung des OLG weiterhin offen:
Da die Kartellrechtswidrigkeit des Vertriebssystems zur Überzeugung des Gerichts feststand, konnte es auf die Bewertung zweier weiterer Einschränkungen, die ebenfalls Gegenstand der ursprünglichen Entscheidung des Bundeskartellamtes waren, verzichten.
Nicht geäußert hat sich das Gericht zum einen zur kartellrechtlichen Zulässigkeit der Einschränkung des Verkaufs über nicht dem Vertragshändler gehörende Internetplattformen (sog. Drittplattformverbot). Diese hochumstrittene Frage liegt derzeit dem Europäischen Gerichtshof zur Entscheidung im Rahmen des Coty-Verfahrens (Az. C-230/16) vor.
Offen ließ das Gericht auch, inwieweit die Verwendung der Herstellermarke auf Webseiten Dritter untersagt werden darf, wenn die Marke dazu verwendet wird, Kunden auf den Online-Shop des Händlers zu leiten. Im vorliegenden Fall betraf dies beispielsweise die Verwendung des Markennamens als Schlüsselwort für Suchmaschinenwerbung und die Schaltung von Werbeanzeigen auf Internetseiten Dritter unter Verwendung des Markenlogos. Betroffen sein kann damit insbesondere auch das Social-Media-Marketing von Online-Händlern. Es bleibt abzuwarten, wie diese Frage durch zukünftige Gerichtsentscheidungen bewertet werden wird.
Für Markenhersteller, die ihre Waren oder Dienstleistungen in Deutschland über ein selektives Vertriebssystem vertreiben, bedeutet die Entscheidung jedoch einmal mehr, ihre Regelungen zum Online-Vertrieb auf die Vereinbarkeit mit der Rechtsauffassung des Bundeskartellamtes zu überprüfen.
Bestens
informiert
Jetzt unseren Newsletter abonnieren, um zu aktuellen Entwicklungen auf dem Laufenden zu bleiben.
Jetzt anmelden