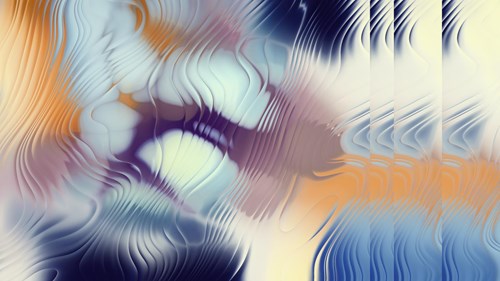Abwerbeverzichtsvereinbarungen im M&A-Kontext: Europäische Kommission verhängt erhebliche Kartellbußgelder
Kartellverstöße auf Arbeitsmärkten erfahren weiterhin große Aufmerksamkeit durch die Wettbewerbsbehörden in der EU. In jüngster Zeit haben die Europäische Kommission („Kommission“) und die französische Wettbewerbsbehörde wegweisende Entscheidungen getroffen, die sich mit kartellrechtlichen Fallstricken von Abwerbeverzichtsvereinbarungen (sog. „no-poach“-Vereinbarungen) auseinandersetzen und für Unternehmen wichtige Erkenntnisse mit sich bringen. Dasselbe gilt für die Schlussanträge von Generalanwalt Emiliou in dem beim EuGH anhängigen „Fußball“-Fall Tondela. All dies hat uns veranlasst, unseren vorigen Artikel zu diesem Thema zu aktualisieren.
EU-Kommission zu Abwerbeverzichtsvereinbarungen im M&A-Kontext
Im Jahr 2018 erwarb Delivery Hero zunächst eine Minderheitsbeteiligung und erst später in 2022 die vollständige Kontrolle über Glovo. Da die ursprüngliche Beteiligung an Glovo Delivery Hero keine Kontrolle verlieh, konnte sich Delivery Hero nicht auf das „kartellrechtliche Konzernprivileg“ berufen, das Konzernunternehmen vom Kartellverbot des Artikels 101 AEUV ausnimmt.
Im November 2023 führte die Kommission unangekündigte Nachprüfungen durch (Pressemitteilung) und stellte im Juni 2025 schließlich mehrere Verstöße gegen Artikel 101 AEUV fest. Die Kommission verhängte gegen Delivery Hero und Glovo erhebliche Geldbußen in Höhe von insgesamt EUR 329 Mio. (siehe hierzu Pressemitteilung):
- Keine Abwerbung von Mitarbeitern. Die beim Erwerb der Minderheitsbeteiligung durch Delivery Hero unterzeichnete Vereinbarung enthielt Klauseln, mit denen beide Unternehmen verpflichtet wurden, auf die Einstellung bestimmter Mitarbeiter des Konkurrenten zu verzichten. Diese Regelung wurde kurz darauf zu einem allgemeinen gegenseitigen Abwerbeverbot erweitert.
- Räumliche Marktaufteilung. Die Unternehmen kamen überein, die nationalen Märkte für Online-Lebensmittellieferungen im EWR untereinander aufzuteilen, indem sie alle bestehenden räumlichen Überschneidungen untereinander beseitigten, von Marktzutritten auf dem Terrain des anderen absahen und Absprachen trafen, welches der beiden Unternehmen auf Märkten tätig werden sollte, auf denen sie bislang noch nicht vertreten waren.
- Austausch sensibler Geschäftsinformationen. Das wettbewerbswidrige Verhalten schloss außerdem den Austausch sensibler Geschäftsinformationen ein. Dieser Austausch ermöglichte es den Unternehmen, ihr Marktverhalten untereinander abzustimmen.
Marktaufteilungen werden regelmäßig als bezweckte Kartellrechtsverstöße eingestuft. Gleichermaßen kann auch der Austausch sensibler Geschäftsinformationen im Einzeöfall eine bezweckte Wettbewerbsbeschränkung darstellen (siehe hierzu unsere früheren NOERR-Insights). Soweit die Entscheidung jedoch Abwerbeverzichtsvereinbarungen betrifft, handelt es sich um die erste Entscheidung der Kommission zu derartigen Vereinbarungen. Allerdings hatte sich die Kommission bereits in ihrem Policy Brief aus Mai 2024 kritisch geäußert: Nach Ansicht der Kommission sind sowohl Gehaltsabsprachen als auch Abwerbeverzichtsvereinbarungen typischerweise als schwerwiegende bezweckte Wettbewerbsbeschränkungen einzustufen. Die Qualifizierung als „bezweckte Wettbewerbsbeschränkung“ entbindet die Wettbewerbsbehörden von der Verpflichtung, die tatsächlichen Auswirkungen des Verhaltens auf den Wettbewerb festzustellen. Eine solche Einstufung von Abwerbeverzichtsvereinbarungen per se als bezweckte Wettbewerbsbeschränkung ist allerdings umstritten (näher hierzu unsere NOERR-Insights).
Die Entscheidung zeigt, dass die Parteien in einem M&A-Kontext sicherstellen müssen, dass keinerlei wettbewerbswidrigen Absprachen oder Anpassungen von Geschäftsstrategien vereinbart werden, wenn die getätigten Investitionen zu keiner vollständigen Kontrolle über das Zielunternehmen führen. Vereinbarungen mit HR-Bezug müssen genau geprüft werden, um mögliche kartellrechtswidrige Beschränkungen zu vermeiden.
Die differenzierte Haltung der französischen Wettbewerbsbehörde zu Abwerbeverzichtsvereinbarungen
Als Reaktion auf einen Kronzeugenantrag leitete die französische Wettbewerbsbehörde Autorité de la Concurrence gegen mehrere französische Unternehmen aus den Bereichen Ingenieurwesen, Technologieberatung und IT-Dienstleistungen eine Untersuchung ein und verhängte kürzlich eine Geldbuße in Höhe von EUR 29,5 Mio., weil sich diese an wettbewerbswidrigen „Gentlemen's Agreements“ beteiligt hatten, die darauf abzielten zu verhindern, sich gegenseitig Führungskräfte abzuwerben und einzustellen. Der Geltungsbereich dieses Gentlemen's Agreement war zeitlich nicht begrenzt und galt für alle Führungskräfte, unabhängig von den ihnen übertragenen Aufgaben oder den ihnen zugewiesenen Kunden. Die französische Wettbewerbsbehörde hob die strategische Bedeutung personeller Ressourcen als ein entscheidender Wettbewerbsparameter hervor und stellte fest, dass Abwerbeverzichtsvereinbarungen schwerwiegende, d. h. bezweckte Wettbewerbsbeschränkungen darstellen.
Die Entscheidung zeigt jedoch, dass die Beurteilung unter Berücksichtigung konkreter Umstände des Einzelfalls im Ergebnis auch anders ausfallen kann. Neben den eben erwähnten Gentlemen's Agreements schlossen die beteiligten Parteien „Partnerschaftsverträge“ ab, die Abwerbeverbote enthielten. Ohne nähere Angaben zu diesen Verträgen oder den relevanten Klauseln zu machen, stellte die französische Wettbewerbsbehörde fest, dass die Klauseln im Rahmen des betreffenden Partnerschaftsvertrags angesichts ihres begrenzten zeitlichen und sachlichen Geltungsbereichs und ihrer Ziele als nicht wettbewerbsbeschränkend eingestuft werden könnten. Die französische Wettbewerbsbehörde wies jedoch auch darauf hin, dass solche Klauseln, je nach den Umständen, als bezweckte Beschränkung anzusehen sein könnten, und gab Unternehmen insofern lediglich eine begrenzte Hilfestellung. Wenig hilfreich ist insoweit auch, dass der Policy Brief der Kommission außerdem nahelegt, dass Abwerbeverzichtsvereinbarungen aus Sicht der Kommission nur schwer vom Kartellverbot ausgenommen werden können, weil sie in der Regel nicht notwendig sind, um zu verhindern, dass Mitarbeiter von Wettbewerbern eingestellt werden. Die Kommission ist der Ansicht, dass es weniger restriktive Alternativen zu einem gegenseitigen Abwerbeverzicht zwischen Wettbewerbern gibt. Als Beispiel verweist die Kommission auf mit den individuellen Arbeitnehmern vereinbarte Wettbewerbsverbote.
Generalanwalt am EuGH Emiliou ist der Auffassung, dass Abwerbeverzichtsvereinbarungen häufig gegen EU-Kartellrecht verstoßen
In der Rechtssache Tondela (C-133/24), die derzeit vor dem Gerichtshof der Europäischen Union („EuGH“) anhängig ist, geht es um Abwerbeverzichtsvereinbarungen in der portugiesischen Fußballliga während der COVID-19-Pandemie. Die portugiesischen Profifußballvereine hatten vereinbart, sich während der Pandemie gegenseitig keine Spieler abzuwerben.
In seinen kürzlich veröffentlichten Schlussanträgen räumt Generalanwalt Emiliou ein, dass Abwerbeverzichtsvereinbarungen im Allgemeinen „alle Merkmale aufweisen, die prima facie als bezweckte Wettbewerbsbeschränkung anzusehen sind.“
Er betont zunächst, dass es auf den jeweiligen Kontext ankomme, und kommt zu dem Schluss, dass Abwerbeverzichtsvereinbarungen im Sport beispielsweise dann keine bezweckte Beschränkung darstellten, wenn der eigentliche Grund der Vereinbarung darin besteht, die Fairness und Integrität des von der Pandemie betroffenen sportlichen Wettbewerbs zu wahren. Zudem hält er vorliegend die Anwendung der Meca-Medina-Rechtsprechung des EuGH für möglich (wonach Abwerbeverzichtsvereinbarungen möglicherweise überhaupt nicht gegen das Kartellrecht verstoßen), „vorausgesetzt, dass die Vereinbarung wirklich darauf abzielt, die Integrität und Fairness des sportlichen Wettbewerbs zu gewährleisten, und hierzu notwendig und angemessen ist“.
Fazit und Ausblick
Unternehmen sind gut beraten, ihre Personalabteilungen regelmäßig zu den Themen Kartellrecht und Dawn-Raids zu schulen. Der Fokus von Wettbewerbsbehörden auf Abwerbeverzichtsvereinbarungen hat in den letzten Jahren deutlich zugenommen. Wenngleich das von Generalanwalt Emiliou angeführte Argument des sportlichen Kontextes die Beurteilung solcher Vereinbarungen in bestimmten Situationen beeinflussen könnte, liegt es nahe, dass Wettbewerbsbehörden Abwerbeverzichtsvereinbarungen wahrscheinlich häufig als verbotene bezweckte Wettbewerbsbeschränkung behandeln werden.
Dieser strikte Ansatz gilt auch im Kontext von Fusionen und Übernahmen, bei denen das kartellrechtliche Konzernprivileg nicht anwendbar ist, da der Erwerber nicht die (vollständige) Kontrolle über das Zielunternehmen erlangt. In solchen Situationen müssen Abwerbeverbote in jeglicher Form genau geprüft werden, da diese nur in Ausnahmefällen zulässig sein dürften.
Bestens
informiert
Jetzt unseren Newsletter abonnieren, um zu aktuellen Entwicklungen auf dem Laufenden zu bleiben.
Jetzt anmelden