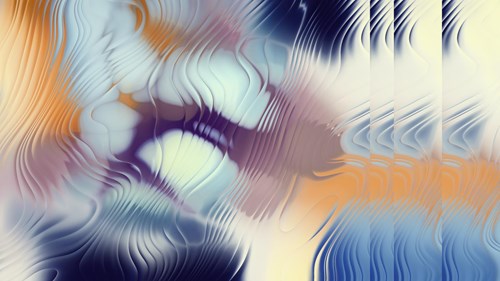Verfassungsgerichtshof Berlin: Berlin bald autofrei?
Der Verfassungsgerichtshof des Landes Berlin hat das Gesetzesvorhaben der örtlichen Bürgerinitiative „Volksentscheid Berlin autofrei“ mit Urteil vom 25. Juni 2025 (Az. VerfGH 43/22) für zulässig erklärt. Die Bürgerinitiative kann damit die nächste Phase des Volksbegehrens einleiten. Die Entscheidung wird kontrovers diskutiert, wie nicht zuletzt das Sondervotum eines Richters zeigt. Trotz gewisser Unterschiede in Stadt- und Flächenstaaten könnte es bundesweit zu entsprechenden Vorhaben kommen.
Was will die Bürgerinitiative?
Die Initiative „Volksentscheid Berlin autofrei“ macht einen radikalen Vorschlag zur Umsetzung der Verkehrswende: Fast alle Straßen innerhalb des Berliner S-Bahn-Rings sollen durch Gesetz zu „autoreduzierten“ bzw. „autofreien Straßen“ werden. Der Kraftfahrzeugverkehr soll vom straßenrechtlichen Gemeingebrauch ausgenommen und zur „verkehrlichen Sondernutzung“ werden. Erlaubt bleiben Fuß- und Radverkehr einschließlich Pedelecs, elektrische Kleinstfahrzeuge sowie Verkehr zu öffentlichen Zwecken (Rettungsdienst, Polizei, Feuerwehr, Post, Müllabfuhr usw.). Damit wären Bezirke wie Mitte, Prenzlauer Berg, Charlottenburg, Wilmersdorf, Kreuzberg, Schöneberg und Neukölln zu weiten Teilen grundsätzlich autofrei. Das Gebiet, in dem mehr als 1 Million Menschen leben, umfasst circa 88 km2.
Pro Kopf sollen zunächst noch 12 Autofahrtage im Jahr erlaubt sein. Eine vierköpfige Familie dürfte ihr Auto damit 48 Tage im Jahr bzw. im Schnitt vier Tage im Monat nutzen, solange jeweils ein Berechtigter im Auto sitzt, der den Fahrzeitraum anzeigt. Auch Fahrgemeinschaften könnten gegenseitig von ihren „Fahrtenbudgets“ profitieren. So soll die Auslastung von Pkw verbessert werden. Bei Gesetzesverstößen soll ein Bußgeld von bis zu 100.000 Euro drohen. Ausnahmen sind vorgesehen für Menschen mit Mobilitätsbeeinträchtigung, den Güter- und Personenwirtschaftsverkehr, gemeinnützige Körperschaften, Taxen und Härtefälle durch lange Arbeitswege oder z. B. Sicherheitsrisiken zur Nachtzeit.
Die neue Rechtslage soll erst vier Jahre nach Inkrafttreten des Gesetzes gelten. Ziel der Bürgerinitiative ist es, durch eine Verringerung des motorisierten Individualverkehrs die Zahl der Verkehrsunfälle zu senken, Sicherheit und Wohlbefinden zu steigern, Lärm und Abgase zu reduzieren und die Wohn- und Aufenthaltsqualität zu steigern.
Wie kam es zu dem Gerichtsverfahren?
Die Berliner Senatsverwaltung prüfte den Entwurf dieses „Gesetzes für gemeinwohlorientierte Straßennutzung“ und befand, dass er gegen höherrangiges Recht verstoße. Sie hatte schon Zweifel, ob das Land Berlin für eine solche Regelung zuständig ist. Die schwerwiegenden Eingriffe in die allgemeine Handlungsfreiheit seien nicht zu rechtfertigen. Auch die Rechtfertigung des Eingriffs in die Eigentumsfreiheit der Fahrzeugeigentümer sei zweifelhaft. Die Bußgeldandrohung sei unverhältnismäßig. 2022 legte sie den Entwurf dem Verfassungsgerichtshof vor.
Was sagt der Berliner Verfassungsgerichtshof?
In seinem Urteil stellt der Berliner Verfassungsgerichtshof mit bemerkenswerter Klarheit fest, dass das Volksbegehren zulässig ist. Insbesondere liegt demnach die Gesetzgebungskompetenz beim Land und das Volksbegehren steht im Einklang mit dem Grundgesetz und sonstigem Bundesrecht, dem Unionsrecht und der Berliner Verfassung.
Nach Auffassung des Gerichts fällt die Schaffung einer autofreien Innenstadt in den Kompetenzbereich des landesrechtlichen Straßenrechts und nicht des bundesrechtlichen Straßenverkehrsrechts. Der Landesgesetzgeber sei berechtigt, das Konzept der Sondernutzung auf den Kopf zu stellen und statt verkehrsfremder Nutzungen den Verkehr selbst einer Erlaubnispflicht zu unterwerfen. Das Verhältnis von Straßenrecht als dem Recht der öffentlichen Sache “Straße” und Straßenverkehrsrecht als Ordnungs- bzw. Straßenverkehrssicherheitsrecht ist kompliziert. Es gilt ein Vorrang des Straßenverkehrsrechts unter Vorbehalt des Straßenrechts: Ob die Straße genutzt werden darf, ist Landessache; wie sie genutzt werden darf, regelt einheitlich der Bund. Der eine Kompetenzträger darf dem anderen nicht dazwischenfunken, insbesondere darf die straßenrechtliche Widmung als Entscheidung darüber, wer die Straße mit welcher Zweckbestimmung nutzen darf – wie also der sogenannte Gemeingebrauch aussieht –, nicht für faktisch straßenverkehrsrechtliche Regelungen missbraucht werden. Üblicherweise werden Straßen für den öffentlichen Verkehr gewidmet. Daran orientiert sich das auf den Kraftfahrzeugverkehr konzentrierte Straßenverkehrsrecht.
Nach Auffassung des Berliner Verfassungsgerichtshofs besteht kein Anspruch auf eine bestimmte Art von Gemeingebrauch. Dieser vermittle lediglich ein Teilhaberecht, die Straße widmungsgemäß zu nutzen. Dabei erkennt der Verfassungsgerichtshof die Bedeutung von allgemein nutzbarem öffentlichem Raum für die tatsächliche Ausübung einer Vielzahl von Grundrechten an. Er leitet aus den Grundrechten insgesamt (ggf. in Verbindung mit dem Sozialstaatsprinzip) einen Anspruch auf ein Minimum an öffentlichen Verkehrswegen ab. Dieses Minimum bleibe aufgrund der nach wie vor bestehenden Mobilitätsmöglichkeiten jedoch gewahrt. Das Straßennetz werde im Kern nicht berührt und stehe den Bürgern weiter zur Verfügung, um sich vor allem zu Fuß, mit dem ÖPNV oder Fahrrad fortzubewegen.
Der Gesetzentwurf ist nach Ansicht des Verfassungsgerichtshof auch mit höherrangigem Recht vereinbar; er verstoße insbesondere nicht gegen Grundrechte oder das Gewaltenteilungsprinzip.
In die Berufsfreiheit werde nicht eingegriffen, da die Regelung keinen berufsregelnden Charakter habe. Sie ziele nicht auf die Tätigkeit einzelner Berufsgruppen ab und weise keinen Zusammenhang zur Ausübung eines Berufs auf. Der Verfassungsgerichtshof sieht auch keinen Eingriff in die Eigentumsfreiheit, weil das Gesetz nicht an das Autoeigentum anknüpfe, sondern die Nutzung öffentlicher Straßen. Anliegern bleibe das Straßennetz und damit die Erreichbarkeit erhalten. Schließlich liege auch kein Eingriff in die allgemeine Handlungsfreiheit vor. Aus den Grundrechten könne kein Anspruch auf die Aufrechterhaltung eines bestimmten Gemeingebrauchs abgeleitet werden, sodass die Grundlage für ein subjektives Recht fehle, das beschnitten wird. Zumindest aber sind etwaige Grundrechtseingriffe nach Ansicht des Verfassungsgerichtshof gerechtfertigt. Das Volksbegehren verfolge mit der Absicht, Verkehrstote sowie verkehrsbedingte Verletzungen zu verringern, klimaschädliche Emissionen zu reduzieren und das Sicherheitsgefühl und Wohlempfinden zu steigern, ein legitimes Ziel. Die vorgesehen Maßnahmen seien zur Zielerreichung geeignet, erforderlich und angesichts der Sondernutzungserlaubnisse und allgemeinen Ausnahmen angemessen.
Der Grundsatz der Gewaltenteilung bleibe gewahrt, auch wenn Widmungsentscheidungen regelmäßig durch die Verwaltung getroffen werden. Punktuelle Gewichtsverlagerungen zugunsten des Parlaments sind demnach mit dem Prinzip der Gewaltenteilung vereinbar, solange der Kernbereich der Exekutive nicht berührt wird. Die bezirksübergreifende Grundsatzentscheidung verlange nach einer einheitlichen Regelung. Die Behörden bleiben für den Vollzug zuständig.
Kritik
Die Bürgerinitiative legt zweifellos einen innovativen Gesetzentwurf vor, mit dem sie ein Statement in der seit Jahren laufenden Verkehrswendedebatte platziert. Mit seiner Entscheidung schreibt der Berliner Verfassungsgerichtshof Rechtsgeschichte. Bei der Lektüre drängen sich allerdings zahlreiche Bedenken auf.
Schon die Beurteilung der Gesetzgebungskompetenz durch den Verfassungsgerichtshof erscheint zweifelhaft. Indem der Entwurf selbst als seine schwerpunktmäßigen Regelungsgegenstände die Verkehrssicherheit, Luftreinhaltung und Lärmbekämpfung nennt, befasst er sich mit Bundesmaterien, für die der Landesgesetzgeber nicht zuständig ist.
Die Initiative verfolgt mit der Reduzierung von Emissionen, weniger Unfällen und einer verbesserten Aufenthaltsqualität legitime Ziele. Dennoch werfen die starke Grundrechtsbetroffenheit und die elementaren Auswirkungen für jeden Einzelnen die Frage auf, ob der Zweck die Mittel heiligt oder ob diese Ziele nicht anders erreicht werden könnten. Die erhebliche Beschränkung des Gemeingebrauchs lässt eine umfassendere Grundrechtsprüfung erwarten, als der Berliner Verfassungsgerichtshof sie durchführt.
Zwar gibt es nach ganz überwiegender Auffassung kein „Grundrecht auf Mobilität“. Das allein macht den Gesetzentwurf aber nicht grundrechtskonform. Die allgemeine Handlungsfreiheit bietet etwa allgemeinen Mobilitätsschutz. Dass der Verfassungsgerichtshof schon einen Eingriff in dieses Grundrecht ablehnt, ist schwer nachvollziehbar und nur durch eine gewagte Schutzbereichsverengung zu erklären.
Auch die Beurteilung der spezielleren Eigentums- und Berufsfreiheit erscheint vermag nicht zu überzeugen. Zur Eigentumsfreiheit lehnt das Gericht zurecht eine Wertgarantie ab, vernachlässigt aber den drastischen Entzug von Nutzungsmöglichkeiten. Die noch verbleibende Sondernutzungserlaubnis steht erkennbar in keinem Verhältnis zu den Kosten einer Fahrzeughaltung und führt zu einer wirtschaftlichen Entwertung der PKW-Nutzung. An dieser Stelle wäre eine Auseinandersetzung mit der Rechtsprechung zu Dieselfahrverboten geboten gewesen, die die Ausweitung der Verbotszone auf eine gesamte Innenstadt für rechtswidrig erklärt. Zweifelhaft ist auch die Ablehnung eines Eingriffs in die Berufsfreiheit. Hier sind nicht nur diejenigen Berufsgruppen wie z. B. Betreiber von Tankstellen, Kfz-Werkstätten und Parkhäusern sowie Fahrdienstleister außerhalb des Personenbeförderungsgesetzes in den Blick zu nehmen, die von der Regelung unmittelbar betroffen sind. Das Vorhaben wirkt sich vielmehr mittelbar auch auf die Arbeitswege jedes Einzelnen sowie die Erreichbarkeit von Einzelhandelsgeschäften und jedes andere Unternehmen aus.
Kritisch zu sehen ist auch die Rechtsschutzverkürzung, die mit der Entscheidungsverlagerung auf den Gesetzgeber einhergeht. Betroffene können gegen die gesetzliche Maßnahme allenfalls eine Verfassungsbeschwerde mit eingeschränktem Prüfungsmaßstab erheben. Bisher steht ihnen gegen entsprechende straßenrechtliche Maßnahmen der Verwaltung ein mehrstufiger Rechtsweg und eine umfassende Rechtmäßigkeitskontrolle offen.
Fragen wirft zudem die praktische Umsetzung auf – wie soll der erhebliche Verwaltungsaufwand bewältigt werden? Gesetze, die kaum vollstreckt werden können, schädigen den Rechtsstaat.
Wie geht es weiter?
Das Abgeordnetenhaus muss binnen vier Monaten über die Annahme des Volksbegehrens entscheiden. Lehnt es das Begehren ab, müssen die Unterschriften von mindestens sieben Prozent der Berliner Wahlberechtigten (ca. 170.000 Menschen) gesammelt werden, bevor ein Volksentscheid stattfinden kann. Das Gesetz ist durch Volksentscheid angenommen, wenn die Mehrheit und zugleich mindestens ein Viertel der Berliner Wahlberechtigten (ca. 610.000 Menschen) zustimmen. In diesem Fall muss es ausgefertigt und verkündet werden. Kommt das Gesetz der Bürgerinitiative zustande, sind weitere Verfassungsrechtsbehelfe – auch in Karlsruhe – möglich und zu erwarten.
Bestens
informiert
Jetzt unseren Newsletter abonnieren, um zu aktuellen Entwicklungen auf dem Laufenden zu bleiben.
Jetzt anmelden