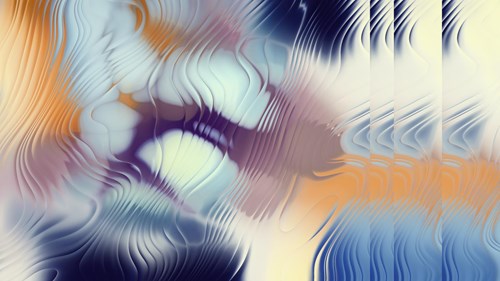Ein neuer EU-Beihilferahmen zur Umsetzung des Clean Industrial Deals
Am 25. Juni 2025 hat die Europäische Kommission („Kommission“) den Rahmen für staatliche Beihilfen zur Unterstützung des Deals für eine saubere Industrie (Clean Industrial Deal State Aid Framework – „CISAF“) erlassen (siehe auch die Pressemitteilung der Kommission). Beim CISAF handelt es sich um eine Maßnahme zur Umsetzung des „Europäischen Clean Deal für die Industrie“ (The Clean Industrial Deal: A joint roadmap for competitiveness and decarbonisation – „Clean Industrial Deal“). Ziel des Clean Industrial Deals ist es, bis 2050 die Klimaneutralität der EU zu erreichen und gleichzeitig die Wettbewerbsfähigkeit der EU zu steigern (mehr zum Clean Industrial Deal auf Noerr Insights). Durch eine Vereinfachung und teilweise Lockerung der bisher geltenden EU-Beihilferegeln ermöglicht der CISAF zukünftig die hierfür notwendigen mitgliedstaatlichen Investitionen.
Der CISAF gilt zunächst bis Ende 2030 und löst den Befristeten Rahmen für staatliche Beihilfen zur Stützung der Wirtschaft infolge des Angriffs Russlands auf die Ukraine – Krisenbewältigung und Gestaltung des Wandels (Temporary Crisis and Transition Framework – „TCTF“) ab. Der TCTF wurde seinerzeit infolge der russischen Invasion der Ukraine erlassen, um es den Mitgliedstaaten zu ermöglichen, betroffene Wirtschaftsbereiche (wie etwa energieintensive Unternehmen) zu unterstützen. Seit dem 25. Juni 2025 findet der CISAF nun auch auf nach dem TCTF angemeldete Beihilfen Anwendung.
I. Erleichterte Voraussetzung für Beihilfen zur Erreichung der Ziele des Clean Industrial Deals
Um die Ziele des Clean Industrial Deal zu erreichen, sieht die Kommission einen Investitionsbedarf vor allem
- zur Beschleunigung des Ausbaus erneuerbarer Energien;
- zum Vorantreiben der Dekarbonisierung der Industrie; sowie
- zur Schaffung ausreichender Fertigungskapazitäten für saubere Technologien in der EU.
Im CISAF legt die Kommission Vorgaben dafür fest, wie zu diesen Zwecken staatliche Förderungen beihilferechtskonform ausgestaltet werden können. Weitgehend sieht der CISAF dabei die Schaffung von Beihilfeprogrammen durch die Mitgliedstaaten vor, teilweise aber auch Einzelbeihilfen (namentlich zur Gewährleistung ausreichender Fertigungskapazitäten für saubere Technologien).
Konkret enthält der CISAF spezifische Vorgaben für Beihilfen in den folgenden Hauptbereichen:
1. Beschleunigung des Ausbaus sauberer Energien und Unterstützung für Stromkosten
a. Beihilfen zum Ausbau sauberer Energien
Mit der Beschleunigung des Ausbaus erneuerbarer Energien und einer verstärkten Nutzung kohlenstoffarmer Brennstoffe (wie blauem und grünem Wasserstoff) möchte die Kommission von Drittstaaten unabhängiger werden, Energiekosten senken und klimaneutral werden. Der CISAF sieht insofern Beihilfeprogramme der Mitgliedstaaten für die folgenden Zwecke vor:
- Investitionen in die Erzeugung von Energie aus erneuerbaren Quellen;
- Investitionen in die Speicherung von erneuerbaren Kraft- bzw. Brennstoffen;
- Investitionen in die Strom- und Wärmespeicherung;
- Investitionen in die Herstellung von kohlenstoffarmen Brennstoffen;
- Investitionen in die Herstellung von erneuerbaren Kraft- bzw. Brennstoffen; sowie
- Investitionen in die Speicherung kohlenstoffarmer Brennstoffe.
Beihilfen zu diesen Zwecken können als Investitionsbeihilfen in jeder Form, beispielsweise als direkte Zuschüsse, Steuervergünstigungen oder Garantien, gewährt werden. Mit Ausnahme der Strom- und Wärmespeicherung können die Beihilfen auch in Form eines direkten Preisstützungssystems (etwa durch Differenzverträge oder Einspeiseprämien) gewährt werden. Die mitgliedstaatliche Unterstützung kann dabei bis zu 100 % der gesamten Investitionskosten beziehungsweise Nettokosten betragen.
b. Beihilfen zur Unterstützung für Stromkosten für energieintensive Unternehmen
Außerdem können Beihilfen zur Förderung von (i) nichtfossiler Stromflexibilität (wie etwa durch Laststeuerung oder Speicherung zur Deckung des Flexibilitätsbedarfs im Strombereich) und (ii) Kapazitätsmechanismen in Form einer strategischen Reserve oder eines marktweiten Mechanismus mit zentraler Beschaffung gewährt werden. Andere Formen von Kapazitätsmechanismen können außerdem weiterhin unter den fortgeltenden Leitlinien für staatliche Klima-, Umweltschutz und Energiebeihilfen („KUEBLL“) genehmigt werden.
Der CISAF ermöglicht darüber hinaus die Einführung eines Industriestrompreises für Wirtschaftszweige, in denen das Risiko einer Abwanderung von Unternehmen in Drittstaaten aufgrund hoher Stromkosten besonders groß ist oder hohe Stromkosten von der Elektrifizierung der Produktionsprozesse abhalten.
2. Dekarbonisierung der Industrie
Des Weiteren können Mitgliedstaaten nach dem CISAF auch Investitionsvorhaben fördern, die entweder zu einer erheblichen Senkung der Treibhausgasemissionen oder zu einer erheblichen Verringerung des Energieverbrauchs industrieller Tätigkeiten führen. „Industrielle Tätigkeiten“ sind Tätigkeiten, die in Industrieanlagen ausgeführt werden und die Produktion von materiellen End- und Zwischenprodukten in großem Maßstab umfassen.
Beihilfen zur Dekarbonisierung der Industrie können nur in Form von direkten Zuschüssen, rückzahlbaren Vorschüssen, Darlehen, Garantien oder Steuervergünstigungen gewährt werden. Die Beihilfehöhe kann im Wege der Beihilfeintensität (Prozentsatz der Gesamtinvestitionskosten), der Berechnung einer Finanzierungslücke oder einer Ausschreibung bestimmt werden.
3. Gewährleistung ausreichender Fertigungskapazitäten für saubere Technologien
Nach dem CISAF können des Weiteren Beihilfen für Investitionsvorhaben gewährt werden, mit denen ausreichende Herstellungskapazitäten für saubere Technologien geschaffen werden. Das betrifft sämtliche Stufen der Wertschöpfungskette – von der Regelung umfasst sind (i) die Herstellung sauberer Endprodukte (wie etwa Batterien und solarthermische Systeme), (ii) die Herstellung wichtigster spezifischer Bauteile (wie Wärmepumpen oder Ammoniak-Cracker) und (iii) die Herstellung von neuen oder rückgewonnenen kritischen Rohstoffen für die vorgenannten Produkte.
Wird die Beihilfe im Rahmen eines Beihilfeprogramms gewährt, kann sie bis zu 55 % der gesamten Investitionskosten eines Vorhabens umfassen und darf höchstens EUR 350 Mio. betragen. Förderungen können außerdem auch als sogenannte Ad-hoc-Beihilfe (von einem Beihilfeprogramm unabhängige Einzelbeihilfe) gewährt werden. Die Höhe der Ad-hoc-Beihilfe bestimmt sich nach dem Betrag der Subvention, die der Beihilfeempfänger für eine gleichwertige Investition in einem Drittland erhalten könnte („matching aid“). Die Höhe wird jedoch auf den Betrag begrenzt, der erforderlich ist, damit die Investition innerhalb des Europäischen Wirtschaftsraums getätigt wird.
In einer am 2. Juli 2025 veröffentlichen Empfehlung regt die Kommission gegenüber den Mitgliedstaaten außerdem an, Beihilfen in diesem Bereich in Form von Steuergutschriften zu gewähren.
Zuletzt: Nicht nur Hersteller von sauberen Technologien, sondern auch deren Nutzer können von Beihilfen profitieren. Der Erwerb und das Leasing von Ausrüstung für saubere Technologien (wie etwa Batterien oder Ausrüstung für die Stromversorgung von Elektrofahrzeugen) können durch eine beschleunigte Abschreibung gefördert werden.
4. Spezifische Innovationsfondsvorhaben
Für die vorgenannten Investitionen können unter weiter erleichterten Bedingungen Beihilfen gewährt werden, wenn das Projekt bereits im Rahmen des Innovationsfonds positiv bewertet wurde. Die Beihilfe darf dabei nur in Form von direkten Zuschüssen, rückzahlbaren Vorschüssen, Darlehen, Garantien oder Steuervergünstigungen gewährt werden.
5. Absicherung privater Investitionen
Schließlich können die Mitgliedstaaten private Investitionen in diesen Bereichen durch Beihilfen in Form von Beteiligungskapital, Darlehen und/oder Garantien für Fonds oder Zweckgesellschaften absichern. Dadurch sollen Anreize für private Investoren geschaffen werden. Pro Vorhaben darf die Beihilfe nicht EUR 250 Mio. beziehungsweise 25 % des gesamten Finanzierungsvolumens des Fonds oder der Zweckgesellschaft übersteigen.
II. Ausblick
Für Unternehmen in energieintensiven Industrien sowie alle im Bereich sauberer Energien tätige Unternehmen (inklusive der Nutzer von „sauberen Technologien“) dürfte der CISAF und daran ansetzende mitgliedstaatliche Förderungen von großem Interesse sein. Denn diesen Unternehmen soll der CISAF einerseits erleichterte Bedingungen für eine mögliche Förderung und andererseits durch die vergleichsweise lange Laufzeit bis Ende 2030 Planungssicherheit bieten. Es steht zu hoffen, dass sich diese Erwartungen der Kommission an den CISAF möglichst rasch in der Praxis verwirklichen. Dies dürfte nicht zuletzt auch von den Mitgliedstaaten abhängen, die die vom CISAF vorgesehenen Beihilfeprogramme aufsetzen müssen.
Für Vorhaben, die die Voraussetzungen des CISAF nicht erfüllen, stehen außerdem weiterhin die parallel neben dem CISAF fortgeltenden EU-Beihilferegelungen, wie die KUEBLL oder die Allgemeine Gruppenfreistellungsverordnung, zur Verfügung.
Unternehmen in den betroffenen Wirtschaftszweigen ist daher in jedem Fall anzuraten, sich kurzfristig mit möglichen staatlichen Förderungen ihrer Investitionen zu befassen. Denn wie der CISAF erneut zeigt, bleiben mitgliedstaatliche Beihilfen auf absehbare Zeit ein wichtiges Mittel zur Umsetzung der klimapolitischen Ziele der EU.
Unser Noerr Kompetenzteam besteht aus erfahrenen Expertinnen und Experten auf dem Gebiet des EU-Beihilferechts und steht für Rückfragen und bei Unterstützungsbedarf gerne zur Verfügung. Melden Sie sich auch gerne hier an, um alle unsere News Alerts zum EU-Beihilferecht und zur Foreign Subsidies Regulation zu erhalten oder klicken Sie hier, um zu unserem neuen FSR-Checker zu gelangen und herauszufinden, ob Ihre M&A-Transaktion nach der Foreign Subsidies Regulation anmeldepflichtig ist.
Bestens
informiert
Jetzt unseren Newsletter abonnieren, um zu aktuellen Entwicklungen auf dem Laufenden zu bleiben.
Jetzt anmelden