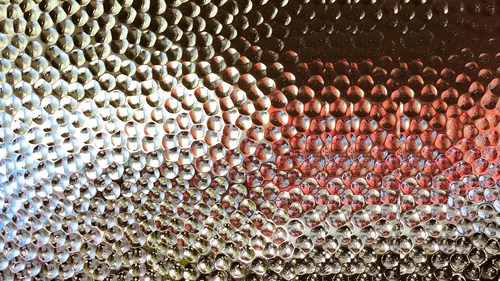Stärkung der Europäischen Verteidigung – Defence Readiness Omnibus der Europäischen Union
Die militärische Verteidigung des europäischen Kontinents ist zu einem der zentralen Politikfelder der Kommission von der Leyen geworden.
Schon im März 2025 hatte die Europäische Kommission ("Kommission") mit ihrem „White paper for European defence – Readiness 2030“ hervorgehoben, welchen enormen Sicherheitsrisiken sie Europa ausgesetzt sieht. Zentral für die Stärkung der Verteidigung sei dabei – neben verstärkten und besser koordinierten Rüstungsaktivitäten der Mitgliedstaaten – vor allem auch eine stärkere und resilientere europäische Verteidigungsindustrie. Die Kommission geht dabei von einem Investitionsbedarf von bis zu EUR 800 Mrd. in den kommenden vier Jahren aus.
Auf diesen ReArm Europe Plan folgt nun der Defence Readiness Omnibus als umfassendes Maßnahmenpaket, um die Verteidigungsfähigkeit der EU-Mitgliedstaaten zu stärken und ihre nationalen Sicherheitsstrategien auf eine gemeinsame europäische Basis zu stellen. Als Teil der Gemeinsamen Sicherheits- und Verteidigungspolitik (GSVP) zielt das Programm darauf ab, nicht nur die militärische Zusammenarbeit zu fördern, sondern auch neue Lösungen für technologische Herausforderungen und operative Bedürfnisse zu entwickeln.
Den zentralen Handlungsbedarf sieht die Kommission in den folgenden vier Punkten:
- Vereinfachung der Beschaffung und Verbringung von Verteidigungsgütern innerhalb der EU
- Entbürokratisierung des Europäischen Verteidigungsfonds
- Beschleunigte Genehmigungen für verteidigungsbezogene Vorhaben
- Klärung horizontaler EU-Rechtsvorschriften (Zugang zu Finanzmitteln, Wettbewerbs-, Umwelt- und Chemikalienrecht), wenn diese unverhältnismäßige oder unbeabsichtigte Beschränkungen für Verteidigungsaktivitäten darstellen.
Wichtige Änderungen und Maßnahmen sieht der Defence Readiness Omnibus insbesondere in den folgenden Bereichen vor:
EU-Wettbewerbsrecht
Die Kommission stellt zunächst klar, dass die EU-Wettbewerbsregeln zwar grundsätzlich auch im Verteidigungssektor gelten. Sie plädiert allerdings für eine sicherheits- und verteidigungssensible Anwendung dieser Regeln.
EU-Beihilferecht
Angesichts der aktuellen geopolitischen Lage rückt die europäische Verteidigungsfähigkeit zunehmend in den Fokus der EU-Politik. Die Kommission betont in diesem Zusammenhang, dass sowohl auf EU-Ebene als auch in den Mitgliedstaaten ein starkes Interesse an einer deutlichen Steigerung der Produktion von Verteidigungsmaterial besteht. Private Marktakteure sind jedoch oft nicht in der Lage, diese Nachfrage kurzfristig und in ausreichendem Umfang zu bedienen. Vor diesem Hintergrund kommt die Kommission zu dem Schluss, dass staatliche Beihilfen zur Förderung von Verteidigungsgütern und verteidigungsbezogenen Dienstleistungen grundsätzlich gerechtfertigt sein können. Sie gelten als notwendig zur Wahrung wesentlicher Sicherheitsinteressen und führen nach Einschätzung der Kommission nicht zwangsläufig zu einer Verzerrung des Wettbewerbs im Binnenmarkt. Wie eine finanzielle Unterstützung aussehen könnte, zeigt die Kommission im Defence Readiness Omnibus auf:
- Kein Vorliegen von Beihilfen bei hoheitlichen Aufgaben: Die Kommission erinnert im ersten Schritt daran, dass staatliche Maßnahmen für hoheitliche Aufgaben bereits keine tatbestandlichen Beihilfen im Sinne des Art 107 AEUV darstellen. Denn hoheitliche Aufgaben erfüllen nicht das Beihilfemerkmal der wirtschaftlichen Tätigkeit. Maßnahmen für generelle Infrastrukturen, wie die Erweiterung von Eisenbahntunneln oder die Erneuerung von Brücken stellen daher, genauso wie Maßnahmen für die Funktionsfähigkeit des Militärs eines Mitgliedstaates, grundsätzlich schon keine Beihilfen dar und müssen somit nicht bei der Kommission angemeldet und von dieser genehmigt werden.
In einem zweiten Schritt erinnert die Kommission daran, dass selbst Maßnahmen, die eine tatbestandliche Beihilfe darstellen, nicht zwangsläufig bei der Kommission angemeldet werden müssen:
- Ausnahme nach Artikel 346 AEUV: Die Kommission spricht hier vornehmlich Artikel 346 AEUV an. Nach Artikel 346 Absatz 1 Buchstabe b AEUV stehen die EU-Vorschriften solchen Maßnahmen, die ein Mitgliedstaat zur Wahrung seiner wesentlichen Sicherheitsinteressen ergreift und die Wettbewerbsbestimmungen auf dem Binnenmarkt nicht beeinträchtigen, nicht entgegen.
- Weitere Gestaltungsoptionen: Bei Beihilfen, die nicht unter Artikel 346 AEUV fallen, wären sekundärrechtliche EU-Vorschriften, die in vielen Fällen eine Vereinbarkeit von Beihilfen mit Artikel 107 AEUV ermöglichen, weitere Genehmigungsgrundlagen. Die Kommission nennt hier ausdrücklich die Allgemeine Gruppenfreistellungsverordnung (VO (EU) 651/2014), die bestimmten Kategorien von staatlichen Beihilfen als mit dem Binnenmarkt vereinbar erklärt, ohne dass diese einzeln bei der Kommission angemeldet und geprüft werden müssen. Auch direkt auf der primärrechtlichen Grundlage des Artikels 107 Absatz 3 Buchstabe c AEUV können Beihilfen zur Förderung der Entwicklung gewisser Wirtschaftszweige als mit EU-Recht vereinbar angesehen werden, wenn sie die Handelsbedingungen nicht in einer dem gemeinsamen Interesse zuwiderlaufenden Weise verändern. Die Produktionsschritte für Verteidigungsmaterial und Verteidigungsdienstleistungen stellen eine solche wirtschaftliche Aktivität dar.
- Bewertungskriterien der Kommission: Die Kommission kündigte zudem an, bei der erforderlichen Abwägung zwischen den positiven und negativen Effekten einer solchen Beihilfe auf den Wettbewerb, deren Beitrag zum Ziel der „defence readiness 2030“ sowie die Besonderheiten des Verteidigungsmarktes – die Mitgliedstaaten kontrollieren Erwerb und Export von Produkten und Technologien mit Verteidigungsbezug – zu berücksichtigen. Positive Effekte einer Beihilfe könnten beispielsweise ein Beitrag zum Schutze von essenziellen Sicherheitsinteressen der Mitgliedstaaten und die Reduktion von Abhängigkeiten von Drittstaaten sein. Zusätzlich stellt die Kommission eine prioritäre Behandlung von Fällen mit Verteidigungsbezug bei der Genehmigung von Beihilfen in Aussicht.
Während die Kommission an den bestehenden Beihilferegelungen festhält, zeigt sie den Mitgliedstaaten Wege auf, um den Verteidigungssektor finanziell zu unterstützen und signalisiert ihre eigene Bereitschaft, der Bedeutung der Produktionssteigerung in diesem Sektor Rechnung zu tragen.
EU-Fördermittel
Bereits vorhandene EU-Fördermittel sollen so ausgestaltet werden, dass sie eine effektive Unterstützung des Verteidigungssektors ermöglichen:
- European Defence Fund („EDF“): Durch den EDF können kollaborative Projekte im Bereich der Verteidigungsforschung und -entwicklung gefördert werden. Die Implementierung des bereits bestehenden EDF soll weiter vereinfacht und flexibler werden. Dabei sollen die Auswahlkriterien für Förderprojekte klarer und einfacher werden sowie flexibler angewendet werden können. Die Umsetzung der EDF-Projekte soll beschleunigt werden. Die Evaluierung von potenziell zu fördernden Projekten soll schneller abgeschlossen werden. Außerdem sollen einmal vorgenommene Bewertungen länger gültig sein und ein System zum einfachen und sicheren Austausch vertraulicher Informationen weiter implementiert werden.
- Öffnung von EU-Fördermitteln für Verteidigungsprojekte: Unter dem InvestEU Fund können Investitionen in Verteidigung bereits heute eingeschränkt gefördert werden. Die Auswahlkriterien für Förderprojekte sollen hier im Hinblick auf eine effektive Nutzung der zur Verfügung stehenden Finanzinstrumenten angepasst werden. Andere EU-Fördermittel wie der „Accelerator, STEP and Scaleup Europe Fund“ sollen für dual-use- und Verteidigungstechnologien geöffnet werden.
EU-Fusionskontrolle
Ein positives Signal für eine Belebung der Zusammenschlussaktivitäten im Verteidigungssektor kommt von der EU-Fusionskontrolle: So hat die Kommission Anfang dieses Monats die Gründung eines Joint Ventures zwischen BAE Systems (Holding) Limited, Japan Aircraft Industrial Enhancement Co. Ltd und Leonardo S.p.A. freigegeben. Ziel dieses Joint Ventures ist die gemeinsame Entwicklung eines Kampfflugzeugs im Rahmen eines trilateralen Programms zwischen dem Vereinigten Königreich, Japan und Italien. Auf dem italienischen Markt gab es horizontalen Überschneidungen, die allerdings keine wettbewerbsrechtlichen Bedenken bei der Kommission bezüglich der Vereinbarkeit mit dem Binnenmarkt hervorriefen und so wurde das Vorhaben genehmigt.
Der veränderten Sicherheits- und Verteidigungslandschaft wird die Kommission bei der aktuell laufenden Überprüfungen der Leitlinien zur Bewertung von Zusammenschlüssen (mehr dazu auf Noerr Insights) Rechnung tragen. Die Kommission wird insbesondere den Gesamtnutzen einer verbesserten Verteidigung und Sicherheit innerhalb der EU bewerten, die zu Effizienzgewinnen führt. Rückmeldungen von Stakeholdern zu Sicherheits- und Verteidigungsaspekten im Rahmen der aktuell laufenden Konsultationen sind dabei essenziell. Betroffene Unternehmen sollten daher von der Möglichkeit, ihre Sichtweise vorzustellen, Gebrauch machen.
Die Kommission betont den Zusammenhang zwischen der Verteidigungsfähigkeit und wettbewerbsfähigen Märkten. Wettbewerbsfähige Märkte fördern Innovationen und Spitzentechnologien sowie eine angemessene und flexible Produktionskapazität. Gleichzeitig wird die Kommission weiterhin versuchen sicherzustellen, dass durch Marktkonzentration bedingte Preiserhöhungen verhindert werden. Die EU-Fusionskontrolle soll dies sicherstellen.
EU-Kartellrecht
Im Bereich des Kartellrechts geht die Kommission auf Kooperationen zwischen Unternehmen im Verteidigungssektor ein und stellt Folgendes vor:
- Unterstützung bei der Erstellung von Kooperationsvereinbarungen: Die Kommission wird Unternehmen bei Kooperationen im Verteidigungssektor spezifische Guidance anbieten, insbesondere wenn die Kooperation notwendig ist, um die Produktion zu steigern oder neue Produkte zu entwickeln und herzustellen. Dadurch würde Rechtssicherheit gewährleistet
- Berücksichtigung von Effizienzen: Bei der rechtlichen Bewertung solcher Kooperationen verspricht die Kommission, Effizienzen im Bereich der Verteidigungsfähigkeit und resilienter Lieferketten für Verteidigungsmaterialien zu berücksichtigen.
Umwelt-, Chemikalien- und Produktrecht
Ein seit langer Zeit großes und als ärgerlich empfundenes Thema ist die sogenannte „Mitgeltung ziviler Vorschriften“. Gemeint ist damit die ausnahmslose Anwendung profaner Industrie-Regulierungen, die Besonderheiten des Defence-Sektors nicht abbilden können.
Genehmigungsverfahren
So werden etwa für flächenraubende Genehmigungsvorhaben (Flughäfen, Kasernen, Truppenübungsplätze oder Hafenanlagen) Vorwürfe in Richtung des als hochgezüchtet wahrgenommenen Umwelt-, Wasser-, Biodiversitäts- und Denkmalschutzrecht gemacht. Das vorliegende Papier der Kommission ermutigt Mitgliedstaaten ausdrücklich dazu, die in vielen europarechtlichen Regelungen angelegten Ausnahmevorschriften für militärische Verwendungen selbstbewusst und großzügig anzuwenden.
Produktkonformität
Eine vergleichbare, wohl noch intensivere Diskussion lösen seit Jahren die dezidiert produktbezogenen Vorschriften des EU-Rechts aus: Gemeint sind damit die für das sicherheitstechnische Design von Industrieprodukten erlassenen Product Safety-Regulierungen etwa aus dem Bereich Maschinensicherheit, Druckgeräteschutz, Persönliche Schutzausrüstungen, EMV- oder Funkanlagenrecht. Hinter diesen Vorschriften verbirgt sich rechtspolitisch die Absicht, gesamtgesellschaftlich erstrebenswerte Ziele wie Gesundheits- und Umweltschutz bereits frühzeitig im technischen Produktdesign zu verwirklichen. Denn das technisch sicher gebaute Anlagenprodukt kann im späteren Betrieb keine Gefährdung für die Nutzer darstellen; die regulative Vorverlagerung aller bautechnischen Sicherheitserwägungen auf den technischen Designprozess garantiert insofern funktionale Sicherheit „an der Quelle“.
Viele dieser Vorschriften sind oder scheinen jedenfalls für den Defence-Bereich zu unflexibel und überstrapazieren die funktionalen Möglichkeiten im Defence-Sektor. Das vorliegende Kommissionspapier adressiert diese Mitgeltung ziviler Vorschriften allerdings nur teilweise: Denn es fokussiert sich im Wesentlichen auf chemikalienrechtliche Vorschriften. Diese sind – diese Beobachtung ist zutreffend – im letzten Jahrzehnt EU-weit massiv angestiegen und übrigens auch für nicht-militärische Industrie eine signifikante Herausforderung worden. Zu sprechen ist etwa von REACH, RohS-Verboten, POP-Verboten oder CLP-Kennzeichnungsvorschriften sowie dem gesamten Bereich des Biozidprodukterechts. Zum Teil – und hierauf weist die Kommission zutreffend hin – sehen diese Produktregulierungen ebenfalls Ausnahmen für die Defence-Bereich vor, so dass auch hier eine selbstbewusste Inanspruchnahme dieser Vorschriften durch die Industrie und die Marktüberwachungsbehörden naheliegt. Die Kommission jedenfalls rät eindringlich dazu.
Rechtspolitisch bleibt aber die europäische Aufgabe übrig, die gesamte Regulatorik verbleibender stoffrechtlicher Vorschriften sowie insgesamt die Regulatorik produktsicherheitsrechtlicher und gegebenenfalls auch betriebssicherheitsrechtlicher Vorschriften auf die zukünftige Notwendigkeit einer Anpassung zu durchforsten. In der Branche wird dazu zum Teil eine gelenkte Umschaltfunktion in Richtung eines „Einsatz-Modus“ diskutiert, um allein im Übungs- und Trainingsfall eine dem zivilen Leben analoge Sicherheit gewährleisten zu können. Zu fragen wäre andererseits auch, ob im gesamten Technologiesegment Ausnahmen für ganze Regulationsbereiche getroffen werden, wie es etwa für den Defence-Sektor in der europäischen KI-Verordnung erfolgt ist. Abschließend muss darauf hingewiesen werden, dass die zivilrechtliche Produkthaftung (auch in der jüngst revidierten Produkthaftungsrichtlinie) keinerlei Dispens für militärtechnologische Güter kennt, soweit der Tatbestand geöffnet ist.
Vergaberecht
Zu den Plänen, den unionsweiten Markt für Verteidigungsgüter zu stärken, gehören auch vielfältige Maßnahmen zur Vereinfachung des Vergaberechts. Die vorgeschlagenen Vereinfachungen betreffen die Richtlinie 2009/81/EG des Europäischen Parlaments und des Rates, die die Beschaffung von Bauleistungen, Gütern und Dienstleistungen in den Bereichen Verteidigung und Sicherheit regelt („Verteidigungsvergaberichtlinie“). Ziel der Anpassungen ist es, den Mitgliedstaaten die notwendige Flexibilität zu geben, um auf neue sicherheitspolitische Herausforderungen reagieren zu können, und gleichzeitig einen wettbewerbsfähigen sowie integrierten europäischen Verteidigungsmarkt zu fördern.
Um dieses Ziel zu erreichen, werden eine Reihe von Neuerungen geschaffen, die den bestehenden vergaberechtlichen Rahmen ändern:
- Anhebung der Schwellenwerte: Der Anwendungsbereich der Verteidigungsvergaberichtlinie wird signifikant eingeschränkt, indem die maßgeblichen Schwellenwerte für Liefer- und Dienstleistungsaufträge von bisher EUR 443.000 auf EUR 900.000 und für Bauaufträge von EUR 5.538.000 auf EUR 7.000.000 erhöht wird. Dadurch soll sichergestellt werden, dass sich die Richtlinie 2009/81/EG künftig auf besonders kritische Aufträge konzentriert, während gleichzeitig der Verwaltungsaufwand für kleinere Vergabeverfahren verringert wird. Unterhalb dieser Schwellenwerte fallen Verteidigungsaufträge in Deutschland somit künftig unter das (verfahrensmäßig sehr flexible) Regime des § 51 UVgO.
- Verfahrensflexibilität: Die Mitgliedstaaten erhalten zusätzliche Flexibilität, alle verfügbaren Instrumente im Bereich der öffentlichen Auftragsvergabe nutzen zu können. Zu diesem Zweck sollen in die Verteidigungsvergaberichtlinie auch die Verfahrensarten des offenen Verfahrens, der Innovationspartnerschaft sowie als besonderes Instrument das dynamische Beschaffungssystem integriert werden. Ziel der – bereits aus der allgemeinen Vergaberichtlinie bekannten – Innovationspartnerschaft ist es, die Entwicklung von Spitzentechnologien und -fähigkeiten zu unterstützen. Sie ist zweistufig ausgestaltet: Im ersten Schritt erfolgt die Entwicklung eines innovativen Produkts, einer innovativen Dienstleistung oder einer innovativen Bauleistung. In der zweiten Phase folgt der Erwerb, vorausgesetzt die innovative Entwicklung entspricht dem vereinbarten Leistungsniveau und Höchstkosten. Die Innovationspartnerschaft fristet indes auch jenseits der Verteidigungsbeschaffung ein Nischendasein. Es darf daher bezweifelt werden, dass dieses Verfahren einen substanziellen Beitrag zur europäischen Wehrhaftigkeit leisten kann. Vielversprechender erscheint dagegen der Plan, ein vereinfachtes Verfahren für die direkte Beschaffung innovativer Produkte und Dienstleistungen zu schaffen, die aus Forschungs- und Entwicklungsprojekten hervorgegangen sind. Diese sollen im Verhandlungsverfahren ohne vorherige Bekanntmachung vergeben werden können (Artikel 2 Abs. 10 des Entwurfs).
- Befristete Ausnahmeregelung für gemeinsame Beschaffungen: Für die gemeinsame Beschaffung militärischer Ausrüstungsgüter durch Auftraggeber aus mindestens drei Mitgliedstaaten, die vor dem 1. Januar 2031 abgeschlossen wird, soll bei identischen oder nur geringfügig modifizierten Verteidigungsgütern ebenfalls eine Vergabe im Verhandlungsverfahren ohne vorherige Bekanntmachung zulässig sein (Artikel 2 Abs. 10) lit. c) des Entwurfs). Dadurch soll auch die Interoperabilität und Austauschbarkeit der Ausrüstung der Streitkräfte verbessert werden (Erwägungsgrund 18 des Entwurfs).
- Beitritt zu Kooperationsprogrammen: Um dem bestehenden Bedarf an stärkerer und besser koordinierter Zusammenarbeit bei Verteidigungsinvestitionen – von der Forschung über die Entwicklung komplexer Systeme bis hin zur Vermarktung und Beschaffung – sowie zur Förderung der technologischen Souveränität der Europäischen Union gerecht zu werden (Erwägungsgrund 19 des Entwurfs), werden die Bestimmungen über den Beitritt von Mitgliedstaaten zu Kooperationsprogrammen auf Grundlage von Forschung und Entwicklung für die späteren Phasen des Lebenszyklus festgelegt und in der Richtlinie 2009/81/EG kodifiziert (Artikel 2 Abs. 6 des Entwurfs).
- Verlängerung der Höchstdauer von Rahmenvereinbarungen: Damit die Mitgliedstaaten längerfristige Partnerschaften mit der Industrie eingehen und ihren Beschaffungsbedarf im Verteidigungsbereich verlässlicher planen können, sieht der Entwurf zudem eine Verlängerung der zulässigen Höchstdauer von Rahmenvereinbarungen von bisher sieben auf künftig zehn Jahre vor (Artikel 2 Abs. 11 des Entwurfs).
- Deutliche Reduzierung der Berichtspflichten: Schließlich legt der Entwurf fest, die Berichtspflichten im Zusammenhang mit der Beschaffung von Verteidigungsgütern zu reduzieren, um den Verwaltungsaufwand für die Mitgliedstaaten zu verringern. Dadurch sollen sich die nationalen Behörden stärker auf die Umsetzung ihrer Verteidigungspolitik und den effizienten Einsatz ihrer Ressourcen konzentrieren können (Erwägungsgrund 23 des Entwurfs).
Einfachere Verbringung von Rüstungsgütern
Zudem beabsichtigt die Kommission, die Verbringung von Rüstungsgütern innerhalb der EU zu vereinfachen, insbesondere im Rahmen EU-finanzierter Verteidigungsprojekte. Hierzu soll die Richtline 2009/43/EG geändert werden, die die Verbringung von Verteidigungsgütern innerhalb der EU regelt. Anlass hierzu sind Sorgen, dass die langwierige nationale Genehmigungsverfahren für Verbringungen Verteidigungsprogrammen der Union verzögern könnten. Im Wesentlichen umfasst der Vorschlag folgende Punkte:
- Ausweitung der Ausnahmen vom Genehmigungserfordernis: Mitgliedstaaten sollen künftig auf Genehmigungen verzichten, wenn Verbringungen zur Durchführung von EU-Verteidigungsprogrammen erforderlich sind, im Rahmen strukturierter grenzüberschreitender Industriepartnerschaften stattfinden, an EU-Institutionen oder die Europäische Verteidigungsagentur erfolgen und im Krisenfall oder im Rahmen militärischer Unterstützung notwendig sind.
- Erweiterung der Allgemeingenehmigungen: Tatbestände der Allgemeinen Genehmigungen sollen künftig neben Verbringungen zu zertifizierten Empfängern auch Verbringungen durch zertifizierte Lieferanten erfassen. Mitgliedstaaten sind zudem angehalten, auch über die bislang in der Richtlinie vorgesehenen Fälle hinaus die Möglichkeit von zusätzlichen Allgemeingenehmigungen vorzusehen.
- Neue Allgemeingenehmigung für EU-Projekte: Neue Allgemeine Genehmigungen sollen sämtliche Verbringungen von Verteidigungsgütern, sowohl materielle als auch immaterielle, abdecken, die im Rahmen von EU-finanzierten Projekten wie dem EDF anfallen. Optional können Mitgliedstaaten festlegen, dass die Genehmigung den gesamten Produktlebenszyklus einschließlich Produktion, Wartung, Aufrüstung umfasst.
- Zugang zu Genehmigungsmöglichkeiten: Mitgliedstaaten sollen die Nutzung der Genehmigungsmöglichkeiten nicht durch sachfremde Erwägungen beschränken. Die Anforderungen der Allgemeinen Genehmigungen sollen daher nur Kriterien enthalten, die für die Einhaltung der Exportkontrolle erforderlich sind.
- Delegierte Rechtsakte der Kommission: Die Kommission soll die Befugnis erhalten, durch delegierte Rechtsakte den Mindestinhalt nationaler allgemeiner Genehmigungen zu bestimmen.
Kontakt
Share
Bestens
informiert
Jetzt unseren Newsletter abonnieren, um zu aktuellen Entwicklungen auf dem Laufenden zu bleiben.
Jetzt anmelden