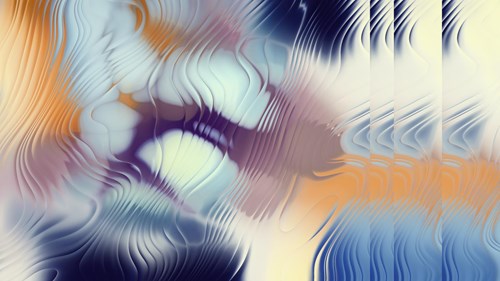Rat der Europäischen Union beschließt die neuen Prioritäten zur Bekämpfung organisierter Kriminalität
Der Rat der Europäischen Union legt alle vier Jahre Themen fest, die in den kommenden Jahren verstärkt in den Fokus strafrechtlicher Ermittlungen und politischer Aufmerksamkeit rücken sollen.
Am 13.06.2025 hat er nun die neuen, für den Zeitraum 2026 bis 2029 geltenden, strategischen Prioritäten im Kampf gegen Kriminalität beschlossen. Organisierte und schwere grenzüberschreitende Kriminalität soll damit gezielter bekämpft werden, um die Sicherheit im Binnenmarkt zu stärken. Die Schwerpunkte betreffen auch wirtschaftsrelevante Deliktsbereiche.
Hintergrund
Die nun beschlossenen Prioritäten werden von der European Multidisciplinary Platform Against Criminal Threats („EMPACT“) umgesetzt. EMPACT selbst ist kein eigenes Ermittlungsorgan der EU, sondern das zentrale, von den Mitgliedsstaaten gesteuerte Koordinierungsinstrument zur Bekämpfung schwerer und organisierter Kriminalität. EMPACT soll eine strukturierte und grenzüberschreitende Zusammenarbeit zwischen den Mitgliedstaaten, EU-Agenturen (wie Europol) und im Einzelfall auch mit Drittstaaten oder privaten Akteuren ermöglichen, um international operierende kriminelle Netzwerke koordiniert zu bekämpfen. Kriminelle Netze, deren Strukturen und Geschäftsmodelle, sollen durch gemeinsame operative Maßnahmen gezielt zerschlagen werden. Darüber hinaus bindet EMPACT nationale Polizei, Zoll-, Steuer- und Justizbehörden mit ein.
Für jede einzelne vom Rat der Europäischen Union festgelegte Priorität werden nun jährliche operative Aktionspläne, also strategische Ziele, ausgearbeitet, umgesetzt und überwacht. Diese operativen Aktionspläne enthalten unterschiedliche Einzelmaßnahmen, beispielsweise Aufbau von Kapazitäten, Durchführung von Schulungen sowie die Konzentration auf kriminelle Netzwerke, von denen ein hohes Risiko ausgeht.
Relevante Prioritäten für Unternehmen
Die Prioritäten für den Zyklus 2026 bis 2029 umfassen mehrere Kriminalitätsbereiche mit unmittelbarer Relevanz für international tätige Unternehmen. Dazu zählen insbesondere:
- Wirtschafts- und Finanzkriminalität: Ziel ist es, kriminelle Netzwerke zu zerschlagen. Der Fokus liegt dabei insbesondere auf Umsatzsteuerkarussellen, Verbrauchsteuer- und Zollbetrug sowie der Umgehung von Sanktionen. Auch Produktpiraterie, Fälschungen von Waren und Währungen nimmt die EU in den Blick, besonders wenn Verbraucher-, Umwelt- oder Sicherheitsrisiken bestehen.
- Online-Betrug: Im Visier stehen organisierte Betrugssysteme über digitale Plattformen, die Privatpersonen, Unternehmen und den öffentlichen Sektor schädigen.
- Geldwäsche und Vermögensabschöpfung: Die EU strebt an, Gewinne aus kriminellen Handlungen konsequenter zu identifizieren und abzuschöpfen. Dazu gehört auch die Bekämpfung von Geldwäsche-Dienstleistern sowie die Analyse von rechtlichen Geschäftsstrukturen, die zur Verschleierung von Vermögenswerten genutzt werden.
- Cyberkriminalität: Im Zentrum stehen Akteure, die gezielte Angriffe auf Unternehmen und kritische Infrastrukturen durchführen, zum Beispiel durch Ransomware oder koordinierte Systemeingriffe.
Fazit und Ausblick
Die neuen EU-Prioritäten setzen die Tendenz fort, Wirtschaftskriminalität verstärkt grenzüberschreitend zu verfolgen. Auch wenn sich die vom Rat der Europäischen Union beschlossenen Prioritäten primär an Strafverfolgungsbehörden richten, gelten sie als Frühindikator dafür, in welche Themenfelder in Europa künftig strafrechtlich genauer hingeschaut werden wird.
Unternehmen in bestimmten Risikobereichen müssen sich daher auf intensivere und grenzüberschreitend abgestimmte Ermittlungen einstellen. Insbesondere bei Umsatzsteuerbetrug, Zollverstößen, Geldwäsche, Cyberangriffen und Online-Betrug können Unternehmen in den Fokus geraten, sei es als wirtschaftlich Beteiligte oder bei fehlender Sorgfalt im Umgang mit Drittparteien. Dabei verschwimmen Täter- und Opferrollen zum Teil, etwa wenn Unternehmen unwissentlich in betrügerische Lieferketten oder Transaktionen eingebunden werden. Ermittlungsbehörden werden in diesen Fällen auch prüfen, ob interne Kontrollsysteme, Prüfprozesse und Meldewege angemessen ausgestaltet sind. Besonders relevant sind:
- Überprüfung von Liefer- und Vertriebsstrukturen im Hinblick auf Umsatzsteuer- und Zollrisiken,
- Implementierung beziehungsweise Überarbeitung eines wirksamen Monitorings zur Vermeidung von Geldwäsche und zur Identifizierung wirtschaftlich Berechtigter; hierbei sollten Unternehmen auch anstehende Gesetzesänderungen in den Blick nehmen und sich frühzeitig darauf vorbereiten, beispielsweise auf den anstehenden Geltungsbeginn der Geldwäscheverordnung samt der damit einhergehenden EU-weiten Anpassung des Geldwäscherechts,
- Implementierung sorgfältiger Prüfprozesse für grenzüberschreitende Zahlungen und Exportgeschäfte, insbesondere mit Blick auf mögliche Sanktionsumgehungen.
Bestens
informiert
Jetzt unseren Newsletter abonnieren, um zu aktuellen Entwicklungen auf dem Laufenden zu bleiben.
Jetzt anmelden