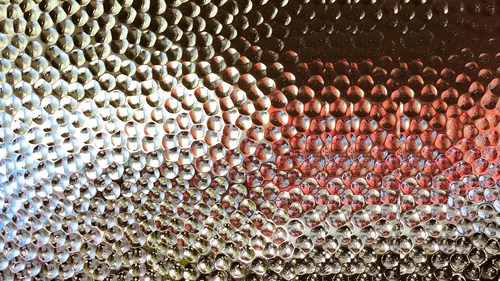Fortschritte im EU-Gesetzgebungsverfahren zur Neufassung der EU-Screening-Verordnung: Änderungen von Parlament und Rat im Blick
Bereits Anfang 2024 stellte die Europäische Kommission einen bedeutenden Vorschlag zur Neufassung der EU-Screening-Verordnung (Verordnung (EU) 2019/452 des Europäischen Parlaments und des Rates vom 19.03.2019 zur Schaffung eines Rahmens für die Überprüfung ausländischer Direktinvestitionen in der Union) vor (vgl. dazu hier). Zu diesem Verordnungsentwurf haben nunmehr das Europäische Parlament Anfang Mai und der Rat der Europäischen Union Mitte Juni Stellung genommen. In diesem Beitrag stellen wir die zentralen Änderungsvorschläge des Parlaments und des Rates vor. Sie bilden die Verhandlungsgrundlage für Gespräche mit dem Parlament und der Kommission („trialogue negotiations“) und werden daher voraussichtlich erheblichen Einfluss auf die Neufassung der EU-Screening-Verordnung haben.
A. Anwendungsbereich der verpflichtenden Investitionsprüfung
Der Rat unterstützt im Grundsatz den Vorschlag, alle Mitgliedsstaaten zu einem Investitionsprüfverfahren zu verpflichten und auch EU-interne Investitionen von in der Union ansässigen Tochtergesellschaften ausländischer Investoren zu erfassen, um Umgehungen zu verhindern. Hintergrund der letztgenannten Forderung ist das Urteil des Europäischen Gerichtshofs in der Rechtssache „Xella“, wonach im Fall von Investitionen von in der Union ansässigen Tochtergesellschaften ausländischer Investoren die EU-Screening-Verordnung nicht anwendbar ist, solange diese Struktur nicht zur Umgehung der Investitionsprüfung verwendet wurde.
Der Rat möchte zugleich den Anwendungsbereich des verpflichtenden Prüfmechanismus auf Militär- und Dual-Use Güter begrenzen (vgl. Art. 4 Abs. 4 der Verhandlungsgrundlage der Mitgliedsstaaten). Von der verpflichtenden Investitionsprüfung ausgenommen werden sollen nach Ansicht der Mitgliedsstaaten Greenfield-Investments. Der Verordnungsentwurf des Parlaments sieht demgegenüber eine Prüfkompetenz der jeweils zuständigen Überprüfungsbehörde für Greenfield-Investments vor.
Einig sind sich Parlament und Rat hinsichtlich interner Restrukturierungen, die grundsätzlich nicht in den Anwendungsbereich der Verordnung fallen sollen (jeweils Art. 1 Abs. 5a der Verhandlungsgrundlage der Mitgliedsstaaten bzw. der Legislativen Entschließung des Parlaments).
B. Kooperationsmechanismus
Das Parlament schlägt vor, dem Kooperationsmechanismus auch Erwerbskonstellationen zu unterwerfen, in denen die Eigentumsstruktur des Investors undurchsichtig ist. Auch im Fall von staatlich kontrollierten Investoren soll der Kooperationsmechanismus verstärkt Anwendung finden.
Die Mitgliedsstaaten möchten vor allem die Anforderungen an die Eingaben innerhalb des Kooperationsmechanismus erhöhen. Kommentare und Stellungnahmen sollen nicht mehr nur „hinreichend begründet“, sondern „hinreichend gerechtfertigt“ sein.
Sowohl die Mitgliedsstaaten als auch das Parlament möchten die Möglichkeiten des Informationsaustauschs zwischen Mitgliedsstaaten untereinander und der Kommission im Vergleich zum Vorschlag der Kommission ausbauen. Gleichzeitig schlagen beide Organe vor, die Kriterien für die Feststellung der nachteiligen Auswirkung eines Erwerbs auf die öffentliche Sicherheit und Ordnung zu präzisieren.
C. Befugnisse der Europäischen Kommission
Einer der zentralen Punkte, die von den Abgeordneten und den Mitgliedsstaaten unterschiedlich bewertet werden, ist die Rolle der Europäischen Kommission. Das europäische Parlament möchte deren Befugnisse erweitern, insbesondere soll die Kommission die Möglichkeit erhalten, bestimmte Investitionen durch Beschluss zu verbieten und Maßnahmen aufzuerlegen (vgl. Art. 7 der Legislativen Entschließung des Parlaments). Im Gegensatz dazu wollen die Mitgliedsstaaten sicherstellen, dass sie selbst in jedem Fall die abschließende Entscheidung in einem Prüfverfahren treffen (vgl. Erwägungsgrund 28 der Verhandlungsgrundlage der Mitgliedsstaaten).
D. Ausblick
Wie eingangs dargelegt, bilden die Stellungnahmen von Rat und Parlament die Verhandlungsgrundlage für die kommenden „trialogue negotiations“. Für die Praxis relevant wird insbesondere sein, in welchem Umfang in den Mitgliedstaaten Investitionsprüfungen in Zukunft verpflichtend sein werden. Wesentlich ist auch die noch offene Frage, ob die Kommission die Befugnis erhalten wird, bestimmte Investitionen durch Beschluss zu verbieten und Maßnahmen aufzuerlegen. Diese Befugnis würde Investitionsprüfverfahren in der Praxis, jedenfalls in bestimmten Konstellationen, aufwendiger machen und in erheblichem Umfang zu einer Europäisierung der Investitionsprüfung führen.
Wir möchten Johanna Cormann für ihren Beitrag zu dieser Veröffentlichung danken.
Bestens
informiert
Jetzt unseren Newsletter abonnieren, um zu aktuellen Entwicklungen auf dem Laufenden zu bleiben.
Jetzt anmelden